

Morgen ist es vier Jahre her. Wir haben uns auf dem Bildschirm getroffen an diesem 15. Dezember 2020, obwohl es mit dem Fahrrad nur ein paar Minuten sind von meinem Uni-Büro bis zu seinem Homeoffice. Corona, okay. Telepolis war für Florian Rötzer da fast schon Geschichte. Sein Vertrag lief noch bis Silvester, aber Harald Neuber, der neue Chefredakteur, stand schon in den Startlöchern. Der Termin wurde so zu einem Glücksfall. Meine Interviews zielen zwar immer auf das „ganze Leben“, aber wann hat man schon einmal die Gelegenheit, tatsächlich Bilanz ziehen zu können, weil eine Sache gerade zum Abschluss kommt, die den Partner bis weit in seine Sechziger getragen hat?
Heute, vier Jahre später, hat das Protokoll historischen Wert. Florian Rötzer erzählt hier die Geschichte des Internets – von der Euphorie des Anfangs über die Ernüchterung, die unweigerlich folgte, bis zu den Kämpfen um Deutungshoheit und Definitionsmacht, die die Spielräume im Netz immer enger werden ließen und vor gut einer Woche Florian Rötzers Kind gefressen haben. Das Archiv von Telepolis ist weg. 50.000 Artikel sind weg und mit ihnen Millionen Kommentare und Gegenkommentare. Wenn man so will: ein Vierteljahrhundert Streitkultur, geschluckt von einem Verlag, dem „Konformität und Gewinn“ offenbar wichtiger sind als das kollektive Gedächtnis der Deutschen.
Gemach, wird der geneigte Leser sagen. Es ist doch nur Telepolis, ein kleiner Laden, den Florian Rötzer viele Jahre mit Minibudget und drei Redakteuren geführt hat und der schon deshalb längst nicht alles abdecken konnte, was dieses Land bewegt hat. Mein „trotzdem“ beginnt mit dem Namen. Ich lasse das am besten Florian Rötzer sagen, Jahrgang 1953, einen Philosophen, der nach dem Magister vom Journalismus lebte. Bayerischer Rundfunk, Kunstforum International. Auch die Süddeutsche Zeitung, die ihm einmal das Wort „Kapitalismus“ strich mit der Begründung, dass Fremdwörter der Verständlichkeit schaden. Aber zum Glück gab es plötzlich auch noch dieses Internet:
Man dachte, dass schlagartig alles anders wird. Die Städte gehen ein. Telearbeit und Teleshopping. Die Gesellschaft revolutioniert sich, weil jetzt alle teilhaben und kooperieren können. Aufbruchstimmung. Ich saß mittendrin und konnte experimentieren.
1995 gibt es in Luxemburg eine Ausstellung über die Stadt der Zukunft. Telepolis, wie sonst, mit Symposium und Onlinemagazin. In den USA wird die Zeitschrift Wired zum Kult und weckt Begehren auch in Deutschland. Der Heise-Verlag springt auf und heuert Florian Rötzer an, den Mann von der Ausstellung. Geld ist kein Thema. Das Internet boomt.
Der Verlag hat gehofft, durch so ein Online-Feuilleton etwas bekannter zu werden. Am Anfang konnten wir gute Honorare zahlen, Leute wie Douglas Rushkoff oder Stanislaw Lem ins Boot holen und Übersetzungen finanzieren. Wir haben das Ganze „Magazin der Netzkultur“ genannt und Einblicke in die Szene geliefert. Politik und Kunst. Telepolis hatte damals noch einen anderen Charakter.
2001 platzt die Blase. Das Budget schrumpft auf weniger als die Hälfte. Florian Rötzer sitzt die meiste Zeit daheim an seinem Bildschirm und hat weder Geld für Reportagen noch für eine Berichterstattung, die mit den Großen auch nur ansatzweise konkurrieren kann. Wer recherchiert schon eine Woche, wenn es nur 80 oder 100 Euro gibt für einen Text?
Ich musste mir etwas anderes überlegen. Das Interesse an Kunst, Literatur und Philosophie war ohnehin begrenzt. Das ist so mit dem Feuilleton. Wir sind dorthin gegangen, wo die Resonanz größer war, zur Politik. Es gab ja dann die Anschläge in New York und Washington. Wir haben gemerkt, dass es auf Interesse stößt, wenn man versucht, andere Blicke auf aktuelles Geschehen zu generieren. Das ist dann auch das Konzept geblieben. Heute sagen das natürlich alle sogenannten alternativen Medien. Für uns war das damals ein Schwenk. Weg von der Netzkultur, hin zu einer kritischen Öffentlichkeit.
Bei unserem Bildschirmtreffen Ende 2020 geht es natürlich auch um Mathias Bröckers und seine Serie „The World Trade Centre Conspiracy“, die als Buch dann ein Bestseller wurde.
Zum Teil ist mir dabei etwas unheimlich geworden. Ganz getragen habe ich das nicht, aber es war ein anderer Blick. Man setzt da schon etwas in die Welt und weiß nicht, was daraus am Ende entsteht.
Schon damals, sagt Rötzer, habe sich abgezeichnet, was das Telepolis-Forum dann in den 2010er Jahren prägen und nicht nur durch jede der großen Krisen prägnanter werden wird. Die Leitmedien schalten die Leser nach und nach einfach ab oder lassen sie nur noch über Belanglosigkeiten sprechen. Kommentare zu, Demokratie tot habe ich 2018 geschrieben und meine Professorenkollegen damit zur Weißglut getrieben. Auch bei Heise wird diskutiert. Es gibt Druck von Werbekunden und vielleicht auch aus der Politik. Der Verlag stellt für das Forum Administratoren ein, die moderieren, löschen, sperren.
Die Leute sind immer aggressiver geworden. Schärfer und unverschämter. Früher war die Diskussionskultur besser. Es gab die Bereitschaft zuzuhören, aufeinander einzugehen und den Artikel auch zu lesen, bevor man kommentiert. (…) Die Kommentarzahl hängt vom Thema ab. Oft entzündet sich das auch intern und hat gar nichts mehr mit dem Text zu tun. Kommentiert wird zu Reiz-Themen. Das ging mit der Flüchtlingsfrage los. Inzwischen geht es auch um die öffentlich-rechtlichen Medien oder um Corona. Das hat einige abgeschreckt, die eher mit Argumenten unterwegs waren. Ich kann das nachvollziehen. Das hat schon etwas von Rudelbildung. Ich habe aber nie daran gedacht, das Forum zu schließen. Wenn ich schon so zurückgezogen lebe, möchte ich das Ohr an den Strömungen „da draußen“ haben. Die Sprache, die Themen. (…) 2001 war schon ein Schnitt. Damals hat sich die Sicht geändert, wie man ein Narrativ richtig erzählt und was man nicht sagen darf. Wer dagegen verstößt, wird seitdem schnell in die irrationale oder verschwörerische Ecke geschoben.
Heute, Ende 2024, trifft der Schnitt auch die, die auf Telepolis noch gut 20 Jahre weitermachen konnten. Florian Rötzer hat sich auf meinem Bildschirm gegen den Begriff „alternatives Medium“ gewehrt. Das könne schön deshalb nicht sein, weil Telepolis „in einem ganz normalen Verlag angesiedelt“ sei, in einem kommerziellen Unternehmen, das „sich dieses Magazin leistet“. Sein Credo? Ein „kritischer Journalismus, der unaufgeregt Themen zur Diskussion stellt, ganz klassisch“. Vor allem das aufnehmen, was sonst „in der Berichterstattung vernachlässigt“ wird und so für „eine freie Diskussionskultur“ sorgen. Öffentlichkeit, so steht es in meinem Rötzer-protokoll, „kann nur partizipativ geschaffen werden“. Übersetzt: Wenn die Leute nicht mitreden dürfen, dann steigen sie aus.
Mit solchen „ganz klassischen“ Ideen war Florian Rötzer schon nach 9/11 „alternativ“, ohne es sein zu wollen. In den späten 2010er Jahren hat er in München regelmäßig in den Telepolis-Salon eingeladen – an Orte, die sonst eher die „Wohlmeinenden" anziehen. Das Hotel Lovelace, die „Alte Utting“. Ich habe dort Horst Teltschik erlebt, Ulrich Teusch, Mathias Bröckers, parallel mit Medienrealität live eine ganz ähnliche Reihe angeboten, hin und wieder für Telepolis geschrieben und einmal auch selbst im Salon geredet. Als die Süddeutsche mich im Frühjahr 2020 auch deshalb attackierte, hat Rötzer erst selbst reagiert und dann auch Marcus Klöckner zu Wort kommen lassen, mit jeweils einer Flut von Kommentaren. Die Links in meiner eigenen Verteidigungsschrift funktionieren jetzt nicht mehr. „Ohne Not, aus freien Stücken“, hat Florian Rötzer gerade den NachDenkSeiten gesagt. Zum Glück habe ich unser Interview drucken lassen.
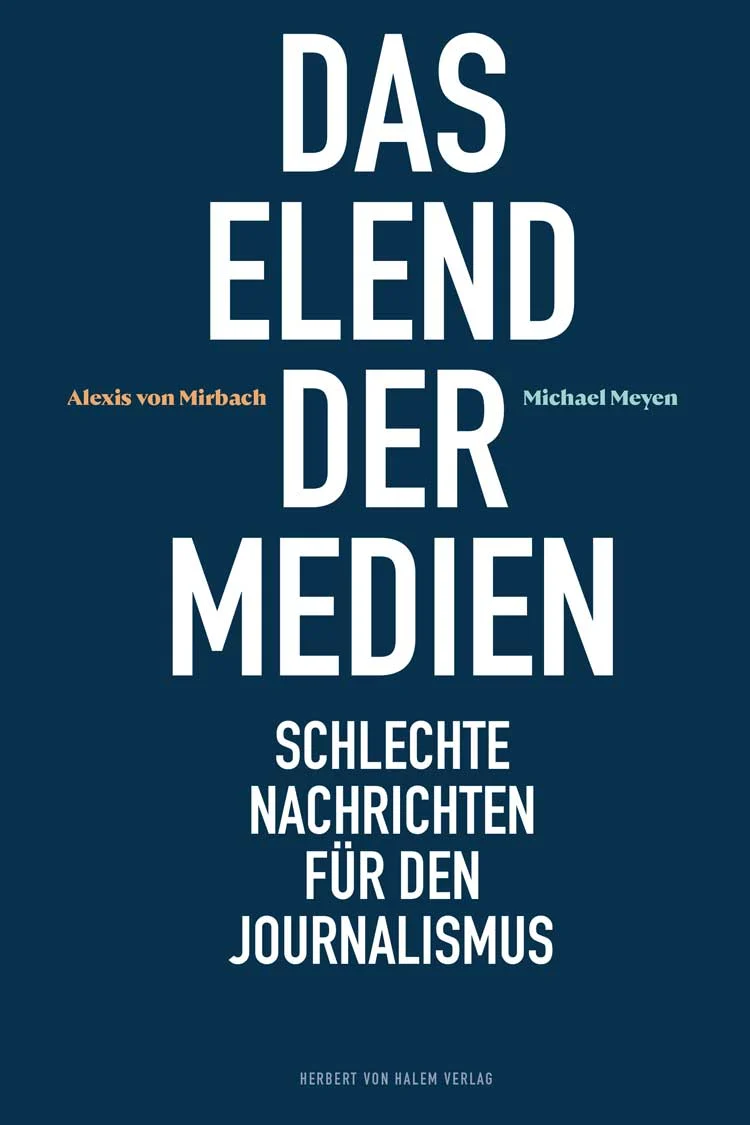
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus