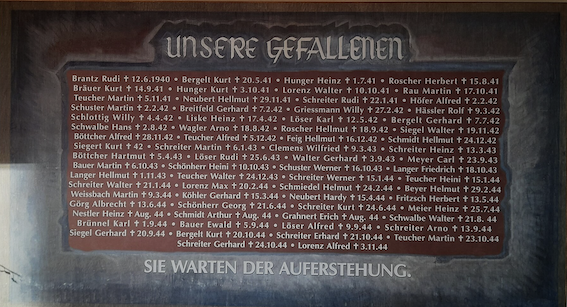
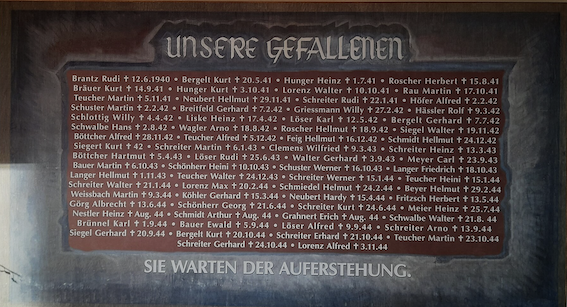
Der Titel ist genial. Chronik eines angekündigten Krieges. Da schwingt der Tod genauso mit wie die Vergeblichkeit. Jeder weiß es, keiner will es, und doch muss es passieren. Gabriel García Márquez. Der Westend-Verlag hat ein Faible für diesen Titel. 2020 schrieb Paul Schreyer die Chronik einer angekündigten Krise, stand damit wochenlang in den Bestsellerlisten und kam in den Jahrescharts des Spiegel auf Platz 20. Das Wort „Chronik“ hatte Schreyer dabei eher lateinamerikanisch ausgelegt und genau wie das literarische Vorbild eher ein Panorama entworfen, das alles, was wir auf der Bühne als „Corona“ beobachten konnten, in ein ganz neues Licht tauchte.
Nun also der Krieg und diesmal tatsächlich das, was man sich landläufig unter einer Chronik vorstellt. Marcus Klöckner steigt am 26. Januar 2022 ein. „Es begann mit 5000 Helmen“. Eine Meldung aus der Zeit, die Christine Lambrecht (ja, lang ist das her) von einem „ganz deutlichen Signal“ sprechen und das von Andrij Melnyk kommentieren lässt. Eine „reine Symbolgeste“, sagt der Botschafter in der Wochenzeitung. „Die Ukraine erwartet eine 180-Grad-Kehrtwendung der Bundesregierung, einen wahren Paradigmenwechsel.“ Klöckner merkt an, dass „weite Teile der Presse“ die Sache mit den Helmen als „lächerlich“ kritisiert haben, und belegt das mit zehn Schlagzeilen.
In diesem Stil geht es weiter bis zum 13. April 2025. Meldungen aus dem In- und Ausland, veröffentlicht in den Leitmedien oder auf Portalen der Gegenöffentlichkeit, Posts auf Facebook und X, Stellungnahmen des Auswärtigen Amtes und der russischen Botschaft. Hin und wieder eine Anmerkung des Chronisten, aber längst nicht so dominant wie in seinem Bestseller „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“ von 2022. „Eine deutsche Sicht“ steht diesmal über Klöckners Dokumentation. In der Einleitung schreibt er:
Sie beinhaltet einerseits zwar auch Ereignisse, die den Ukraine-Krieg betreffen, spiegelt aber vor allem auch die Berichterstattung wider. (S. 10)
Entstanden ist so ein einzigartiges Zeitdokument, in dem der Kriegsgegner Marcus Klöckner die allermeiste Zeit in der Deckung bleiben kann. Das Material steht für sich und kommentiert sich selbst.
Historische Tiefe bekommt diese Chronik durch einen Text von Marc Trachtenberg, einem US-Politikwissenschaftler, Jahrgang 1946, der sich auf den alten und den neuen kalten Krieg spezialisiert hat und in diesem Buch die ewig junge Frage nach den Versprechen neu aufrollt, die der Westen der Sowjetunion 1990 in Sachen Nato-Osterweiterung gegeben hat. Wenn man so will: die Vorgeschichte der Vorgeschichte, die manche erst 2014 beginnen sehen und die bei Marc Trachtenberg wenigstens andeutungsweise bis zu Woodrow Wilson und Versailles verlängert wird und bis zur Nachkriegsordnung von 1945.
Dieser Text, in den USA schon vor ein paar Jahren der veröffentlicht und nun übersetzt von Ekkehard Sieker, liefert, wenn man so will, das, was Paul Schreyer und Gabriel García Márquez den Leser in ihren Geschichten entdecken lassen. Hier wie dort sind wir selbst gefordert. Marc Trachtenberg sagt: Wie man die westlichen Zusagen, ihre Verbindlichkeit und mögliche Täuschungsabsichten sieht, hänge „von den moralischen und politischen Werten ab, die man vertritt“ (S. 64).
Bei Marcus Klöckner ist das keine Frage. Er rundet seine Chronik mit einer „Schlussbemerkung“ ab, die den Übergang von der Ampel zu Schwarz-Rot einfängt und mit der Feststellung endet, dass das „Feindbilddenken“ im Vordergrund stehe und die „Positionen und Überzeugungen“ festgefahren seien. Klöckners letzter Satz ist so wuchtig wie das Buch:
Der Titel „Chronik eines angekündigten Krieges“ lässt sich demgemäß auch im Hinblick auf einen zukünftigen Krieg zwischen Russland und der NATO lesen – möge es nicht so weit kommen. (S. 205)
Für die knapp 500 Fußnoten und Literaturverweise gibt es übrigens einen QR-Code. Um bei García Márquez zu bleiben: Lesen in den Zeiten der Papierknappheit.
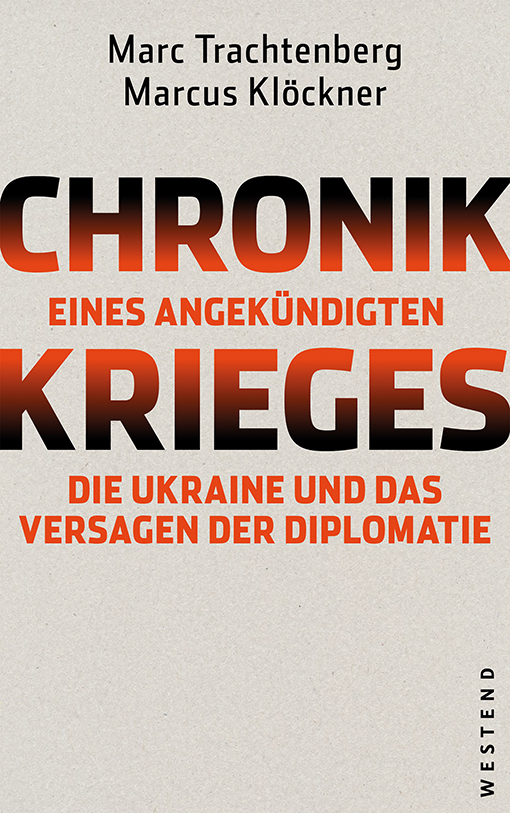
Der Text oben war erst ein paar Stunden online, als uns die folgende Besprechung erreichte. Wir veröffentlichen diesen Text, weil er Michael Meyen widerspricht und so hoffentlich die Diskussion zum Buch anregen kann.
Dem Westend Verlag kommt das Verdienst zu, immer wieder Bücher von Abweichlern zu Mainstream-Positionen zu verlegen. Marcus Klöckner ist ein solcher. Sein Co-Autor Marc Trachtenberg, 1946 geboren, ist ein US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler mit der Spezialisierung auf Diplomatiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Diesbezüglich waren die Voraussetzungen ausgezeichnet, ein gutes, informationsreiches und reflexionsstarkes kleines Werk vorzulegen.
Das Büchlein ist tatsächlich informationsreich, darüber hinaus aber merkwürdig disparat. Auf eine kurze Einführung von Klöckner folgen 67 Seiten von Trachtenberg allein zu der Fragestellung: Gab es bindende Zusagen der Amerikaner, die NATO nicht gen Osten auszuweiten? Diese Frage ist zwar nicht irrelevant, aber in Trachtenbergs Untersuchung kommen so viele Betrachtungsweisen und Details zur Sprache, sie ist dermaßen akribisch und ausführlich, daß sich zumindest bei der Rezensentin ein leichter Überdruß einstellte. Trachtenberg dekliniert Argumente dafür und Argumente dagegen durch, um zu dem Ergebnis zu kommen: Es ist eine Auslegungsfrage und möglicherweise sogar seitens der Russen ein Mißverständnis. Vorsätzliche Täuschung sei der Bush/Baker-Regierung nicht vorzuwerfen. Im Moment des Aussprechens seien die Zusicherungen ernst gemeint gewesen. Die politische Lage änderte sich aber sehr schnell, vor allem für Rußland, und der Warschauer Pakt löste sich auf, so daß die Amerikaner meinten, die Schwäche des vormaligen Erzfeindes ausnutzen zu können und zu sollen, um ihr Militärbündnis zu erweitern.
Wirklich interessant ist für bestimmt nicht wenige Leser der Anhang III unter der Überschrift „Das Problem der ‚doppelten Eindämmung‘“. Hier erfahren wir, daß die US-Politiker 1990 auch ihr altes Nachkriegsdiktum, Deutschland müsse dauerhaft niedergehalten werden, in ihre Überlegungen zum Fortbestand der NATO einbezogen hatten. Nicht nur den Russen, sondern auch den Deutschen konnte man nicht trauen. Deutschland müsse ein im Wesentlichen westliches Land werden. Trachtenberg zitiert den US-Botschafter in Moskau, Jack F. Matlock (1987 bis 1991, und den Ex-Präsidenten Joseph Biden. Matlock:
Wir müssen die NATO beibehalten, weil wir Deutschland unter Kontrolle halten müssen. Deutschland vereinigt sich – wollen Sie es von allem loslösen oder wollen Sie es an ein Bündnis binden, damit es kein unabhängiges Militär hat? Was würde ein unabhängiges Deutschland, das sich Atomwaffen zulegt, in zwei Generationen für den Frieden der Welt bedeuten? (2016)
Biden, über den Zweck der NATO Auskunft gebend:
Es ging nicht nur darum, Russland einzudämmen (…) Sie sollte Deutschland einbinden; sie sollte Stabilität in Europa bringen; und sie war nie, nie, nie nur dazu da, Russland einzudämmen. (1997)
Wie man heute weiß, ist auch der gegenwärtige Krieg Rußlands gegen die Ukraine von den USA unter anderem deshalb provoziert worden, um ein allzu enges Miteinander von Deutschland und Rußland auf allen möglichen Gebieten zunichte zu machen. Jede bilaterale Sicherheitsabsprache zwischen Bonn/Berlin und Moskau habe zu unterbleiben. Zbigniew Brzezinskis geopolitisches Grundsatzwerk von 1998 „The Great Chessboard“ läßt grüßen.
Es folgt die titelgebende Chronologie, zusammengestellt „aus deutscher Sicht“. Die politischen Ereignisse und Statements werden anhand von Zitaten aus den Mainstreammedien, X-Postings und Drucksachen der Bundesregierung aufgelistet, hin und wieder mit einer Anmerkung – Interpretation oder Richtigstellung – von Klöckner versehen. Der rekapitulierte Zeitraum liegt zwischen Januar 2022 und April 2025. Und in dieser Kurzcharakteristik liegt auch die Krux der Publikation: - Da die Chronologie erst 2022 beginnt, liegen die Ereignisse seit 2014 außerhalb der Betrachtung, obgleich nur mit diesem Hintergrundwissen der Überfall Rußlands auf die Ukraine 2022 zu verstehen ist. - Die Beschränkung auf die Leitmedien (einmal werden die Nachdenkseiten zitiert) hat zur Folge, daß die Darstellung im Wesentlichen mit den Auffassungen der herrschenden politischen Klasse zusammenfällt.
Alternative Deutungen und Informationen, die nur in den freien Medien zu lesen und zu hören waren, fehlen schmerzlich und werden von den gelegentlichen Anmerkungen Klöckners nicht ersetzt. Der vorsätzliche Bruch des Minsker Vertrages durch die EU 2014ff. findet somit keine Erwähnung. Die Vorschläge Rußlands zu einer Vereinbarung von reziproken Sicherheitsgarantien zwischen Rußland und der NATO bzw. der USA lange und kurz vor Kriegsbeginn, die von den Adressaten ignoriert oder verworfen wurden, bleiben ebenfalls unerwähnt. Die Verhandlungen zwischen Rußland und der Ukraine im März 2022 in Belarus und der Türkei werden auf sechs Zeilen abgehandelt, und das auch noch als Zitat einer Meldung der Tagesschau. Desgleichen der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline im Juni 2023 – und jeweils ohne Anmerkungen Klöckners.
Man fragt sich, an welche Leser dieses Büchlein gerichtet ist. Die einen wissen das alles und mehr. Die anderen kennen die Darstellungen aus den Leitmedien. Einen Erkenntniswert sieht die Rezensentin für kein Segment der Leserschaft – höchstens für jemanden, der seit Januar 2022 im Koma lag und gerade erst das trübe Licht der Welt neu erblickt.
Marc Trachtenberg, Marcus Klöckner: Chronik eines angekündigten Krieges, Die Ukraine und das Versagen der Diplomatie. Frankfurt/Main: Westend 2025. 208 Seiten, 20 Euro.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus