

Die drei für das geistige Leben Europas entscheidenden Science-Fiction-Entwürfe des 20. Jahrhunderts erschienen vor und nach dem 2. Weltkrieg: 1932 Aldous Huxleys „Brave new world“, 1948 Georges Orwells „1984“ und 1954 Ray Bradburys „Fahrenheit 451“. Davor und dazwischen, in den Jahren 1907, 1920 und 1940, erblickten drei nicht minder bedeutende dystopischer Romane das Licht der Welt: „Die eiserne Ferse“ (Jack London), „Wir“ (Jewgenij Samjatin) und „Kallocain“ (Karin Boye). Ich möchte sie auf dieser Plattform in einem weiteren Dreiteiler vorstellen.
„Die eiserne Ferse“ von Jack London (1876 bis 1916), den einst jedes Kind als Verfasser von Abenteuerliteratur kannte, ist kein wirklicher Science-Fiction-Roman und auch keine echte Dystopie. Er wird unter dieser Bezeichnung geführt, weil die dürre Rahmenhandlung im Jahr 419 nach der sozialistischen Weltrevolution spielt, wo ein 700 Jahre altes Manuskript gefunden wird. Darin wird die US-Gesellschaft der Jahre 1912 bis 1918 geschildert, und zwar von der Frau eines Revolutionärs. Eher also ein Social-Fiction-Werk, in dem 1907 eine Vorausschau auf die USA der 1910er Jahre vorgenommen wird. Die erfolgreiche Weltrevolution hat also in des Schriftstellers Kopf um das Jahr 2200 herum stattgefunden. Der Roman hat einen eigenen Eintrag bei Wikipedia, so daß ich mich hier auf Eckpunkte der Handlung beschränken und auf die Besonderheiten dieser Vision konzentrieren kann.
Jack London entwirft ein verheerendes Bild der sozialen Lage der USA im Jahr 1912. Die aus besseren Verhältnissen stammende Avis schildert als aktive Revolutionärin an der Seite ihres Ehemanns Ernst Everhard, was sie sieht und erlebt, erfährt und versteht – eine Art Tamara Bunke (Kampfgefährtin von Che Guevara aus der DDR).
Die US-Konzerne haben einen Klassenkampf von oben entfacht, zerstören den Mittelstand, lassen Arbeiter unter unzumutbaren Bedingungen tätig sein, verschärfen die Kinderarbeit und fühlen sich so sicher, daß sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung verarmen lassen. Sie kaufen alles auf, schließen sich zu Kartellen zusammen, die vom Arbeiterführer Ernst Everhard als Oligarchen bezeichnet werden und den anschaulichen Namen „Eiserne Ferse“ bekommen. Aus dieser Megamaschine gehen alle relevanten staatlichen Institutionsangestellten und Journalisten hervor. Es gibt kein Recht für die Armen, die Arbeiter und die Angestellten, und sie haben auch keine Stimme in der Presse. Alle unabhängigen und kritischen Stimmen (etwa Gewerkschaftszeitungen) werden von der Eisernen Ferse niedergetrampelt.
Bereits im Vorwort des fiktiven Herausgebers des gefundenen Manuskripts wird man auf eine Eigentümlichkeit stoßen: Anthony Meredith entpuppt sich als veritabler marxistischer Geschichtsphilosoph, wenn er schreibt, daß die Erhebung der Oligarchen – also die Revolution von oben durch einen „tiefen Staat“ – Anlaß geheimer Verwunderung bei Historikern und Philosophen gewesen sei. „Primitiver Kommunismus, Besitzsklaverei, Leibeigenschaft und Lohnsklaverei waren die notwendigen Meilensteine auf dem Weg der menschlichen Entwicklung.“ Die Eiserne Ferse dagegen sei ein Fehltritt oder Rückschritt, jedenfalls geschichtsteleologisch unnötig gewesen. „In dem ordnungsgemäßen Vorwärtsschreiten [sic!] der sozialen Entwicklung war kein Platz für sie“. Und: Sie würde „die große Merkwürdigkeit der Geschichte bleiben“. (25) Selbst geistige Riesen wie Herbert Spencer hätten geglaubt, „daß auf den Kapitalismus der Sozialismus folgen würde“ (26). Stattdessen gebar er in seiner Überreife den ungeheuren Sproß „Oligarchie“. Die sozialistische Bewegung habe diese Aberration nicht rechtzeitig erkennen können.
Eine derart mechanische Betrachtung des Geschichtsverlaufs war dem dogmatisierten Marxismus tatsächlich eigen – für Marx selbst war dieser Blickwinkel ein abstrakter unter vielen. Unerwartete Entwicklungen dienten ihm dazu, seine Theorien zu überarbeiten und zu verfeinern, nicht dazu, allem Überraschenden die Existenzberechtigung abzusprechen. Aber auf dieser seiner intellektuellen Höhe befanden sich seine Adepten nicht, und Bewegungen und Organisationen wie Parteien haben immer die Tendenz zur Simplifizierung und Dogmatisierung, da sie um der Popularisierung und der Propagierung willen einer Vulgarisierung nahezu unvermeidlich Vorschub leisten. Jeder in diesem Sinne ideologisch gewordenen Theorie wohnt daher Tragik inne – die Tragik des Scheiterns hoher Ideale, Wünsche und Ziele. Der sich daraus speisende Aktivismus möchte noch zu Lebzeiten des Enthusiasten den Erfolg genießen und zumindest die Grundsteinlegung einer gerechten, humanen Gesellschaft erleben. Zwangsläufig sind Aktivisten, ist die Avantgarde ungeduldig, in ihrem Urteilsvermögen eingeschränkt und in der Verwendung der Mittel nicht wählerisch. Damit der Elan der Hoffenden nicht erlahmt, springen ihrer Anführer notgedrungen und regelmäßig zu kurz. Die kommunistischen Glaubenseifrigen neigen nur in geringem Maße der Einstellung religiös Gläubiger zu, der zufolge irgendwann die Erlösung kommt und es eher unwahrscheinlich ist, daß sie zu Lebenszeiten noch zu deren Zeugen und Profiteuren gehören würden. Ideologischer Glaube hat eine geringere Halbwertzeit, und seine Adepten reagieren meist schon auf die erste Niederlage mit einem Rückzug ins Privatleben. Sie sind höchstens ein weiteres Mal dazu zu überreden, den Stein noch einmal hochzurollen und damit hohe Risiken für sich und ihre Familie einzugehen.
Jack Londons „Eiserne Ferse“ beschreibt diese Konstellation und diesen Prozeß als Rollenprosa. Er zeigt die Protagonisten in ihren typischen Charaktermasken, ohne ihnen aber individuelle Züge zu versagen. Zwar ist die Typisierung stärker als die Individualisierung, aber in den tagebuchartigen Manuskripten von Avis Everhard wird ein lebhaftes Bild entwickelt von zwanzig Jahren Klassenkampf in den USA der 1910er und 1920er Jahre, wie er hätte sein können. Da werden Flugblätter verteilt. Da wird demonstriert und gestreikt, daß es eine Art hat. Da wird geschossen, verletzt, gebombt, gestorben, sich optisch verwandelt und undercover gelebt, verraten und verkauft, gelogen, gespitzelt und gegengespitzelt, geplündert, aus Gefängnissen befreit, geliebt, verzweifelt, gepredigt, gehofft, gehaßt … – alles, was das revolutionäre (oder besser das Revoluzzer-) Herz begehrt.
Und sollte dem Leser immer noch nicht das Wasser im Munde zusammenlaufen, weist die Rezensentin auf eine interessante Parallele hin: Bezüglich der Idee der Weltrevolution und des Arbeiterkampfes liegt Jack London auf einer Linie mit den drei hier behandelten englischen Dystopikern. Was jedoch den Stil des Werkes betrifft, gewissermaßen das ästhetische Konzept, die Szenerie und Dynamik, sind große Ähnlichkeiten mit den ebenfalls ideologisch untersetzten Klassikern der liberal-konservativen Schriftstellerin Ayn Rand zu bemerken. Deren Hauptwerk „Atlas Shrugged“ von 1957 (auf Deutsch unter den Titeln „Atlas wirft die Welt ab“, „Wer ist John Galt?“, „Der Streik“ und 2023 in einer Neuübersetzung unter dem Titel „Der freie Mensch“ erschienen) ist eine 1500-seitige literarische Bebilderung der ökonomisch-sozialen Weltanschauung der libertären Radikalmarktwirtschaftlerin.
Sie schildert ähnliche Verhältnisse wie Jack London, nur aus der Sicht des freien Unternehmertums, das den Staat als Umklammerer und Behinderer wirtschaftsunternehmerischen Aktivismus‘ erfährt, welcher allein allgemeine Zufriedenheit in einer stabilen Gesellschaft garantieren könne. Besteuerung, Auflagen und Vorschriften durch den Staat und seine Gesetze werden existenzbedrohend, die Mittelschicht erodiert, so daß bei Rand die Unternehmer streiken und nicht die Arbeiter. Beide Romane ergänzen sich hervorragend. In beiden wird ein radikaler Versuchsaufbau vorgenommen, und der US-amerikanische Geist der Freiheit durchweht spürbar das Geschehen. Die Handlung besteht aus ähnlichen Elementen wie in der „Eisernen Ferse“. Dramatik, Spannung und ein Hauch von Abenteuer auf der Basis der Durcharbeitung von Grundsätzlichem und Konkretem, von Grundsätzlichem im Konkreten. Wie gern läse man einmal einen derartigen Roman über deutsche sozialökonomische Verhältnisse. Der Verfasser müßte dafür gar nicht über viel Fantasie verfügen. Der Staat spielt in der Gegenwart eine ähnlich gesellschaftsverheerende Rolle wie bei Jack London und Ayn Rand. Die Szenerie müßte also nur auf den neuesten Stand gebracht werden.
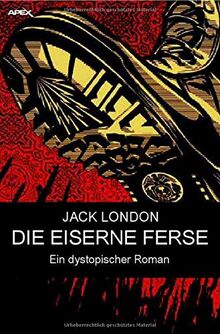
Jack London: Die eiserne Ferse. Ein dystopischer Roman. epubli 2018, 384 Seiten, 15 Euro
Beate Broßmann, Jahrgang 1961, Leipzigerin, passionierte Sozialphilosophin, wollte einmal den real existierenden Sozialismus ändern und analysiert heute das, was ist – unter anderem in der Zeitschrift TUMULT. Am Buch-Tresen steht sie jeden zweiten Donnerstag.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus