

„Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt“ steht auf dem Cover. Sicher: Ein Verlag will verkaufen. Superlative machen sich da immer gut. Der Weltfrieden und Deutschland. Wie das, wird mancher fragen, über den Atlantik schauen, nach Kiew oder gar noch Moskau und nach Peking, und die 24 Euro ausgeben. Ich kann nur sagen: Das ist gut investiert, wenn man verstehen will, was uns die Nachrichtensprecher und ihre Kritiker im Moment alles um die Ohren hauen. Ich durfte die Texte von Hauke Ritz schon lesen und ein Vorwort schreiben, in dem es nicht nur um Krieg und Frieden geht, sondern auch um die Frage, warum sich manche, die einst „links“ zu stehen glaubten, inzwischen mit einigen Konservativen besser vertragen als mit den alten Genossen – nicht nur bei der Gretchenfrage auf dem Cover. Nun aber zu meinem Vorwort.
Hauke Ritz hat meinen Blick auf die Welt verändert. In diesem Satz stecken zwei Menschen. Ich fange mit dem Leser an, weil jeder Text auf einen Erfahrungsberg trifft, gewachsen durch all das, was Herkunft, soziale Position und Energievorrat ermöglichen. Ob ein Autor dort auf Resonanz stößt, kann er nicht beeinflussen. Also zunächst etwas zu mir. Ich bin auf der Insel Rügen aufgewachsen – in einer kommunistischen Familie und mit Karl Marx. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. In der Schule haben wir Kinder uns über ein anderes Marx-Zitat amüsiert, das in einem der Räume groß an der Wand stand. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ Kömmt. Dieser Marx. Was der sich traut.
Das Schulhaus ist nach 1990 schnell abgerissen worden. Bauland mit Meerblick, fünf Minuten bis zum Strand. Marx stand nun zwar kaum noch in der Zeitung, Eltern, Freunde und Bekannte waren sich aber trotzdem sicher, dass er Recht hat. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hier die Ostdeutschen, auf Jahre gebunden im Kampf um Arbeitsplatz und Qualifikationsnachweise, Rente und Grundstück, und dort Glücksritter aus dem Westen, die sich das Dorf kaufen und nach ihrem Bilde formen. Das Kapital live in Aktion gewissermaßen.
Ich selbst bin damals eher durch Zufall an der Universität gelandet und habe dort eine Spielart der Medienforschung kennengelernt, die in den USA erfunden worden war, um den Zweiten Weltkrieg nicht nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, sondern auch in den Köpfen. Diese akademische Disziplin konnte und wollte nach ihrer Ankunft in der alten Bundesrepublik nichts mit Marx am Hut haben. Zum einen war da dieser neue Freund auf der anderen Atlantikseite, moralisch sauber und damit ein Garant gegen den Vorwurf, mitgemacht und vielleicht sogar Goebbels und sein Postulat von den Medien als Führungsmittel immer noch in sich zu tragen. Je lauter dieser Vorwurf wurde, desto stärker zog es deutsche Propagandaforscher, die sich zur Tarnung Kommunikations- oder Publizistikwissenschaftler nannten, in die USA. Zum anderen verbannte der Radikalenerlass jeden Hauch von Marxismus aus dem universitären Leben. Selbst Postmarxisten wie Adorno und Horkheimer mit ihrer Frankfurter Schule, Karl Mannheim oder Pierre Bourdieu, auf die ich bei der Suche nach einer neuen intellektuellen Heimat fast zwangsläufig gestoßen bin, spielten in den Lehrveranstaltungen kaum eine Rolle und damit auch nicht in Dissertationen, Habilitationen, Fachzeitschriften. Peer Review wird schnell zur Farce, wenn jeder Gutachter weiß, dass bestimmte Texte nur von mir und meinen Schülern zitiert werden. Ich habe dann versucht, die Kollegen mit Foucault zu überraschen, aber auch das hat nicht lange funktioniert.
Zu Hauke Ritz ist es von da immer noch weit. Ich habe eine Lungenembolie gebraucht (2013), zwei Auftritte bei KenFM (2018) und die Attacken, die auf diese beiden Interviews zielten sowie auf meinen Blog Medienrealität, gestartet 2017 und zeitgleich mit großen Abendveranstaltungen aus der virtuellen Welt in die Uni-Wirklichkeit geholt, um bereit zu sein für diesen Denker. Corona nicht zu vergessen. Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend. Narrative Nummer 16 im August 2020. Hauke Ritz zu Gast bei Robert Cibis, Filmemacher und Kopf von Ovalmedia. Das saß jemand, der mühelos durch die Geschichte spazierte und es dabei schaffte, geistige und materielle Welt zusammenzubringen. Meine Götter Marx, Bourdieu und Foucault, wenn man so will, angereichert mit mehr als einem Schuss Religionswissen, um die jemand wie ich, als Atheist erzogen und immer noch aufgeregt, wenn er vor einer Kirche steht, eher einen Bogen macht. Dazu all das, was ich in tapsigen Schritten auf dem Gebiet der historischen Forschung zu erkunden versucht hatte – nur in weit längeren Zeiträumen und mit der Vogelperspektive, die jede gute Analyse braucht. Und ich kannte diesen Mann nicht. Ein Armutszeugnis nach mehr als einem Vierteljahrhundert in Bewusstseinsindustrie und Ideologieproduktion.
Und damit endlich zu diesem Autor, der meinen Blick auf die Welt verändert hat. Hauke Ritz, Jahrgang 1975, ist ein Kind der alten deutschen Universität. Er hat an der FU Berlin studiert, als man dort noch Professoren treffen konnte, denen Eigenständigkeit wichtiger war als Leistungspunkte, Deadlines und politische Korrektheit. Seine Dissertation wurzelt in diesem ganz anderen akademischen Milieu. Ein dickes Buch, in dem es um Geschichtsphilosophie geht und um die Frage, welchen Reim sich die Deutschen vom Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer auf den Siegeszug von Wissenschaft und Technik gemacht haben. Das klingt sehr akademisch, wird aber schnell politisch, wenn man die Aufsätze liest, die Hauke Ritz ab den späten Nullerjahren auf diesem Fundament aufgebaut hat und die hier nun in einer Art Best-of in die Öffentlichkeit zurückgeholt werden aus dem Halbdunkel von Publikationsorten, deren Reputation inzwischen zum Teil gezielt zerstört worden ist, und so hoffentlich ein großes und neues Publikum erreichen. In den Texten, die auf dieses Vorwort folgen, geht es um den tiefen Staat und den neuen kalten Krieg, um Geopolitik und Informationskriege und dabei immer wieder auch um die geistige Krise der westlichen Welt sowie um den fehlenden Realitätssinn deutscher Außenpolitik.
Bevor ich darauf zurückkomme, muss ich die Doppelbiografie abrunden, mit der ich eingestiegen bin. Im Februar 2022, wir erinnern uns auch mit Hilfe des Interviews, das Paul Schreyer mit ihm führte, war Hauke Ritz gerade in Moskau, als Universitätslehrer auf Zeit mit einem DAAD-Stipendium. Im November 2024, als ich diese Zeilen schreibe, ist er wieder einmal in China, mit familiären Verbindungen. Das heißt auch: Hauke Ritz hat mehr gesehen, als einem in den Kongresshotels der US-dominierten Forschergemeinschaften je geboten werden kann. Und er muss weder um Zitationen buhlen noch um irgendwelche Fördertöpfe und damit auch nicht um das Wohlwollen von Kollegen. Ein Lehrstuhl oder eine Dozentenstelle, hat er mir im Frühsommer 2021 auf Usedom erzählt, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, so eine ganz normale akademische Karriere sei für ihn nicht in Frage gekommen. Der Publikationsdruck, die Denkschablonen. Lieber ökonomisch unsicher, aber dafür geistig frei. Ich habe mir diesen Satz gemerkt, weil er einen Beamten wie mich zwingt, seinen Lebensentwurf auf den Prüfstand zu stellen. Bin ich beim Lesen, Forschen, Schreiben so unabhängig, wie ich mir das stets einzureden versuche? Wo sind die Grenzen, die eine Universität und all die Zwänge setzen, die mit dem Kampf um Reputation verbunden sind? Und was ist mit dem Lockmittel Pension, das jeder verspielt, der das Schiff vor der Zeit verlassen will?
Hauke Ritz, das zeigen die zehn Aufsätze, die in diesem Buch versammelt sind, hat alles richtig gemacht. Hier präsentiert sich ein Autor, der „von links“ aufgebrochen ist und sich immer noch so sieht (so beschreibt er das dort, wo es um die aktuelle Theorieschwäche des einst gerade hier so dominanten Lagers geht), aber trotzdem keine Angst hat, für ein Wertesystem zu werben, das eher konservativ wirkt. Herkunft und Familie zum Beispiel. Verankerung und Zugehörigkeit, sowohl geografisch als auch intellektuell. Mehr noch: Wenn ich Hauke Ritz richtig verstanden habe, dann braucht es ein Amalgam aus den Restbeständen der »alten« Linken und dem christlich geprägten Teil des konservativen Lagers, um eine Entwicklung aufzuhalten und vielleicht sogar umzukehren, die in seinen Texten das Etikett »Postmoderne« trägt. Grenzen sprengen, Identitäten schleifen, Traditionen vergessen. Umwertung aller Werte. Transgender und Trans- oder sogar Posthumanismus. Wer all das nicht mag, findet in diesem Buch ein Reiseziel. Gerechtigkeit und Utopie, Wahrheitssuche, der Glaube an die Schöpferkraft des Menschen und die geistige Regulierung politischer Macht – verwurzelt in der Topografie Europas, die Konkurrenz erzwang, und vor allem im Christentum, weitergetragen in weltlichen Religionen wie dem Kommunismus und so attraktiv, dass Hauke Ritz von Universalismus sprechen kann, von der Fähigkeit dieser Kultur, ein Leitstern für die Welt zu sein.
Ich habe die Texte im Frühling 2022 gelesen, allesamt in einem Rutsch, um mich auf das Gespräch vorzubereiten, das ich mit Hauke Ritz dann im Juni für die Plattform Apolut geführt habe, den Nachfolger von KenFM. Ich weiß, dass das ein Privileg ist. Lesen, worauf man Lust hat, und dafür auch noch bezahlt werden. Ich weiß auch, dass ich ohne die Vorgeschichte, ohne Corona und all das, was mich und dieses Land dorthin geführt hat, niemals das Glück hätte empfinden können, das mit der Entdeckung eines Autors wie Hauke Ritz verbunden ist. Ohne all das wäre ich wahrscheinlich weiter zu irgendwelchen hochwichtigen Tagungen in die USA geflogen und hätte mich mit Aufsätzen für Fachzeitschriften gequält, die für einen winzigen Kreis von Eingeweihten gemacht und selbst von diesem Kreis allenfalls registriert, aber nicht studiert werden.
Lange Gespräche mit Köpfen wie Hauke Ritz hatten bei Ovalmedia oder Apolut in den Coronajahren sechsstellige Zuschauerzahlen. Ein großes Publikum, wenn man die Komplexität und die Originalität mitdenkt, die jeder Leser gleich genießen kann. Man findet diese Videos noch, allerdings nicht beim De-facto-Monopolisten YouTube, der Zensur sei Dank. Im Bermudadreieck zwischen Berlin, Brüssel und dem Silicon Valley verschwindet alles, was die hegemonialen Narrative herausfordert und das Potenzial hat, Menschenmassen erst zu erreichen und dann zu bewegen. Ich habe Hauke Ritz deshalb schon im Studio und am Abend nach unserem Dreh ermutigt und wahrscheinlich sogar ein wenig gedrängt, aus seinen Aufsätzen ein Buch zu machen. Das war auch ein wenig egoistisch gedacht: Ich wollte mein Aha-Erlebnis mit anderen teilen und so Gleichgesinnte heranziehen. Der Mensch ist ein Herdentier und mag es nicht, allein und isoliert zu sein.
Drei Jahre später gibt es nicht nur die Aufsatzsammlung, die Sie gerade in den Händen halten, sondern auch ein Buch, das ich als „großen Wurf“ beschrieben habe – als Werk eines Autors, der die Wirklichkeit nicht ignoriert (Geografie, Reichtum und die Geschichte mit ihren ganz realen Folgen), sich aber trotzdem von der Vorstellung löst, dass der Mensch in all seinem Streben und Irren nicht mehr sei als ein Produkt der Umstände. Hauke Ritz dreht den Spieß um: Die Geschichte bewegt nicht uns, sondern wir bewegen sie. Was passiert, das passiert auch und vielleicht sogar in erster Linie, weil wir ganz bestimmte Vorstellungen von der Vergangenheit und unserem Platz in dieser Welt verinnerlicht haben. Von diesem Axiom ist es nur ein klitzekleiner Schritt zur Machtpolitik: Wenn es stimmt, dass das historische Bewusstsein mindestens genauso wichtig ist wie Atomsprengköpfe, Soldaten oder Gasfelder, dann können sich die Geheimdienste nicht auf Überwachung und Kontrolle beschränken. Dann müssen sie in die Ideenproduktion eingreifen. Und wir? Wir müssen die Geistesgeschichte neu schreiben, Politik anders sehen und zuallererst begreifen, dass der Mensch das Sein verändern kann, wenn er denn versteht, wer und was seinen Blick bisher gelenkt hat. Ich bin deshalb besonders froh, dass es auch das Herz der Serie „Die Logik des neuen kalten Krieges“ in dieses Buch geschafft hat, ursprünglich 2016 bei RT-Deutsch erschienen. Diese Stücke sind exemplarisch für das Denken von Hauke Ritz. Der Neoliberalismus, um das nur an einem Beispiel zu illustrieren, wird dort von ihm nicht ökonomisch interpretiert, „sondern als ein Kulturmodell“, das zu verstehen hilft, wie es zu der Ehe von Kapitalismus und „neuer Linker“ kommen konnte und damit sowohl zu jener „aggressiven Dominanz des Westens“, die auch den Westend-Verlag umtreibt und so diese Publikation ermöglicht, als auch zur „Vernachlässigung der sozialen Frage“.
Hauke Ritz holt die geistige Dimension von Herrschen und Beherrschtwerden ins Scheinwerferlicht und fragt nach der „Macht des Konzepts“. Diese Macht, sagt Hauke Ritz nicht nur in seinem Aufsatz über die „kulturelle Dimension des Kalten Krieges“, hat 1989/90 den Zweikampf der Systeme entschieden. Nicht die Ökonomie, nicht das Wohlstandsgefälle, nicht das Wettrüsten. Ein Riesenreich wie die Sowjetunion, kaum verschuldet, autark durch Rohstoffe und in der Lage, jeden Feind abzuschrecken, habe weder ihre Satellitenstaaten aufgeben müssen noch sich selbst – wenn da nicht der Sog gewesen wäre, der von der Rockmusik ausging, von Jeans und Hollywood, von bunten Schaufenstern und von einem Märchen, das das andere Lager als Hort von Mitbestimmung, Pressefreiheit und ganz privatem Glück gepriesen hat. Als selbst der erste Mann im Kreml all das für bare Münze nahm und Glasnost ausrief (das, was der Westen für seinen Journalismus bis heute behauptet, aber schon damals nicht einlösen konnte und wollte), sei es um den Gegenentwurf geschehen gewesen. Die Berliner Mauer habe der Psychologie nicht standhalten können.
Fast noch wichtiger: All das war kein Zufall, sondern Resultat strategischer und vor allem geheimdienstlicher Arbeit. Hauke Ritz kann sich hier unter anderem auf Francis Stonor Saunders und Michael Hochgeschwender stützen und so herausarbeiten, wie die CIA über den Kongress für kulturelle Freiheit in den 1950ern und 1960ern Schriftsteller und Journalisten finanzierte, Musiker und Maler, Zeitschriften, Galerien, Filme – und damit Personal, Denkmuster, Symbole. Die „neue“ Linke, „nicht-kommunistisch“, also nicht mehr an der System- und Eigentumsfrage interessiert, diese „neue“ Linke ist, das lernen wir bei Hauke Ritz, genauso ein Produkt von Ideenmanagement wie das positive US-Bild vieler Westeuropäer oder eine neue französische Philosophie um Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss oder Bernard-Henri Lévy, die Marx und Hegel abwählte, stattdessen auf Nietzsche setzte und so ein Fundament schuf für das „Projekt einer Umwertung aller Werte“.
Natürlich kann man fragen: Was hat all das mit uns zu tun? Mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Zukunft Europas oder gar mit der These auf dem Buchcover, dass nichts weniger als der „Weltfrieden“ ausgerechnet von uns, von Deutschland abhängt? Warum sollen wir uns mit Kämpfen in irgendwelchen Studierstübchen beschäftigen, die höchstens zwei Handvoll Gelehrte verstehen? Hauke Ritz sagt: Wer die Welt beherrschen will, muss den Code der europäischen Kultur umschreiben. Wie weit dieses „Projekt“ schon gediehen ist, sieht jeder, der die Augen öffnet. In der Lesart von Hauke Ritz ist Europa Opfer einer „postmodernen Fehlinterpretation seiner eigenen Kultur“, importiert aus den USA und nur abzuwehren mit Hilfe von Russland, das zwar zu Europa gehöre, sich vom Westen des Kontinents aber unterscheide und deshalb einen Gegenentwurf liefern könne. Stichworte sind hier Orthodoxie und Sozialismus sowie eine Vergangenheit als Imperium, ohne die, so sieht das Hauke Ritz, neben diplomatischen Erfahrungen die „politischen Energien“ fehlen, die nötig sind, um Souveränität auch da zu bewahren, wo die „Macht des Konzepts“ beginnt. China und der Iran ja, Indien und Lateinamerika nein.
Keine Angst, ich schreibe hier kein zweites Buch. Diese Appetithäppchen sollen Lust machen auf einen Autor, der die Hektik der Gegenwart hinter sich lässt und aus den Tiefen der Geschichte eine Interpretation anbietet, die die hegemoniale Ideologie in ein ganz neues Licht rückt und sie so als „Rechtfertigungslehre“ enttarnt (Werner Hofmann) oder als „Machtinterpretation der Wirklichkeit“ (Vaclav Havel), die sich zwangsläufig „ritualisiert“ und „von der Wirklichkeit emanzipiert“, um als „Alibi“ für alle funktionieren zu können, die mit der Macht marschieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Marx-Zitat mit dem komischen Wort „kömmt“ als kleiner Junge gedeutet habe. Ich wusste wenig von Philosophie und gar nichts von der Welt. Hauke Ritz blickt nicht nur in Abgründe, die ich vorher allenfalls aus dem Augenwinkel gesehen hatte, sondern bietet zugleich eine Lösung an. Als Gleichung und in seinen Worten formuliert: „klassische Arbeiterbewegung“ plus „christlich orientierte Wertkonservative“ ist gleich Hoffnung und Neustart. Und nun Vorhang auf für einen Philosophen, der nicht nur Deutschland einen Weg weist in Richtung Veränderung und Frieden.
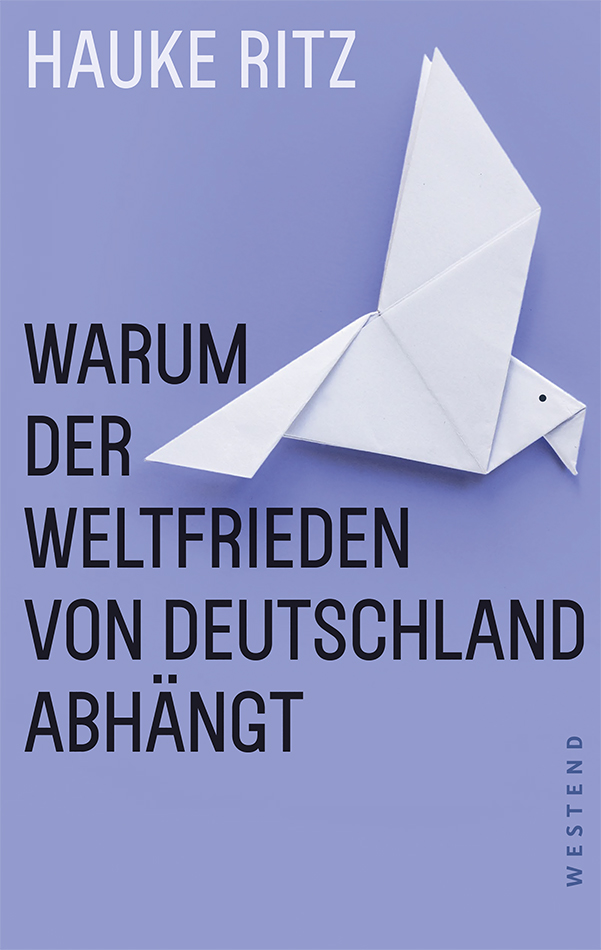
Hauke Ritz: Warum der Weltfrieden von Deitschland abhängt. Frankfurt am Main: Westend 2025, 224 Seiten, 24 Euro.
Berichte, Interviews, Analysen