

Am Anfang steht der Besuch eines Adventskonzerts. Hier beobachtet die namenlose Ich-Erzählerin eine Familie: Vater, Mutter und die 16-jährige Tochter. Die Eltern weisen die Tochter zurecht, weil sie nicht das tut, was sie von ihr erwarten. Am liebsten möchte sich die Tochter verkriechen ... Diese Beobachtung erinnert die 47-jährigen Schriftstellerin an ihr eigenes sechzehnjähriges Ich: Damals lebte sie mit ihren Eltern und den drei Geschwistern in Oslo in kleinbürgerlichen Verhältnissen, die möglicherweise „ein Tatort“ waren.
Die Mutter befand sich in ständiger Angst und entwickelte einen kaum auszuhaltenden Kontrollzwang über diese eine Tochter. Sie roch an ihr, um festzustellen, ob sie geraucht oder getrunken hatte. Sie wollte nicht, dass die Tochter Umgang mit Jungs hatte, weil sie befürchtete, dass sie schwanger werden könnte. Diese Angst besaß einen „ganz eigenen Geruch“. Eigentlich hätte sie Mitleid empfinden müssen für ihre Mutter, aber sie musste sich vor ihr schützen, weil die Mutter immer wieder ihre Grenzen übertrat.
„Sie hasste mich und ging auf mich los, und es kam mir vor, als wollte sie unter meine Kleider und unter meine Haut und in meinen Kopf kriechen, um meine Gedanken zu lesen und zu sehen, was ihre unerträgliche Angst verursachte, aber weil das nicht möglich war, dichtete sie mich zurecht.“ Der Vater rettete sie immer mal wieder vor der Mutter: „Jetzt lass doch das Mädel in Ruhe.“
Um mit ihren Freundinnen auf Partys zu gehen, zu trinken und auch Jungs zu treffen, belog sie ihre Mutter. Und dann verliebte sie sich in einen älteren Jungen. „Wenn man sechzehn Jahre alt ist und einen Freund hat, tut man es, man ist erwachsen und niemand kann es verhindern.“ Sie versprach sich selbst, dass es passieren würde.
Das erste Mal hat nicht stattgefunden oder war misslungen. Sie aber wollte ihr Tagebuch nicht enttäuschen und schrieb alle ihre erotischen Sehnsüchte – wie im Rausch und aus Protest gegen die Mutter – hinein und füllte damit ihre tiefe Leere mit Wörtern. Das Tagebuch war ihr vertrauter Raum, ihr Ort des Selbstgespräches.
Doch dann passiert es: Die Mutter liest das Tagebuch und zeigt es dem Vater. Durch dieses Ereignis und die Reaktion des Vaters wird der Tochter klar, dass sie ihrem eigentlichen Trauma auf der Spur ist. Ein Abgrund tut sich auf. Alle Energie der Eltern fließt in das Verschweigen und Vertuschen, in das Aufrechterhalten des Bildes einer heilen Familie. Sehr beeindruckend und gelungen formt die Autorin aus dem Geschehen ein Psychogramm der drei Personen und der Situation.
Gastland der diesjährigen Buchmesse in Leipzig war Norwegen. Wiederholung erschien gerade rechtzeitig. In Deutschland ist die Norwegerin Vigdis Hjorth bereits durch zwei Romane bekannt: Die Wahrheiten meiner Mutter und Ein falsches Wort.
In ihren drei auf Deutsch erschienenen Romanen geht es um Lebenslügen, Familienkonflikte und Missbrauch. Auch wenn die Autorin eine Verbindung zu ihrer Familie verneint, haben die ersten beiden Bücher heftige Reaktionen bei dieser verursacht. Als eine Art Gegendarstellung beschreibt eine der Schwestern ihre Sicht in einem eigenen Roman.
Wiederholen, erinnern, erleben und wieder erzählen – ein andauernder Prozess. Die Frage ist, ob eine solche Wunde jemals heilen kann. „Die Wiederholung ist der Ernst des Daseins“, so zitiert Hjorth Kierkegaard in ihrem intensiven und berührenden Roman.
Vigdis Hjorth schreibt dieses außerordentliche Buch mit Mitte 60. Damit ist zu vermuten, dass ihr Erinnern auch ein Neuerfinden ist. Für ihre Bücher wurde sie in Norwegen bereits mehrfach ausgezeichnet. Übersetzt wurde der Roman aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs.
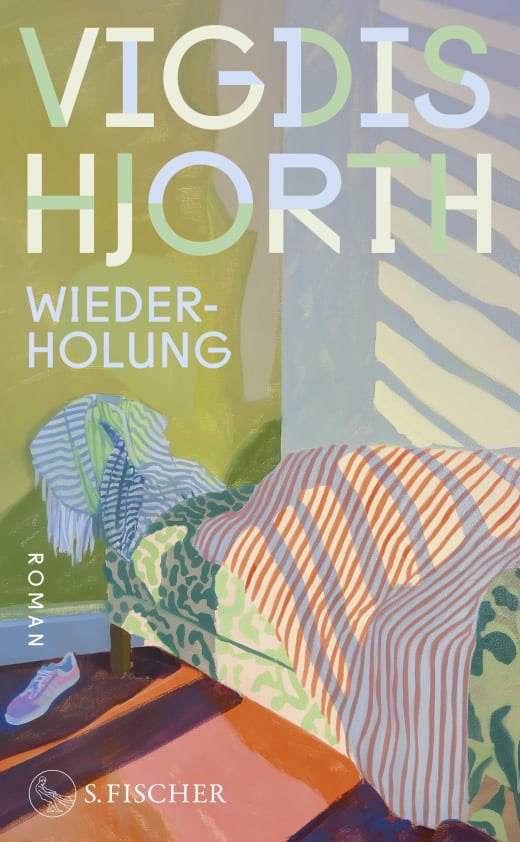
Vigdis Hjorth: Wiederholung. Frankfurt am Main: Verlag S. Fischer, 160 Seiten, 22 Euro.
Nach einer langen Managementkarriere widmet sich Sabine Keuschen ihrer Leidenschaft für Literatur und arbeitet in einer Buchhandlung.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus