

„Sourie freute sich auf den Tod“: Mit diesen Worten beginnt die Kölner Schriftstellerin. Der 27-jährige Sourie hatte sein Studium der Philosophie und Geschichte mit Auszeichnung abgeschlossen. Jetzt arbeitet er als Pförtner in einem Pflegeheim, um in der Nähe von Menschen zu sein, die ihre letzte Adresse bezogen haben. Den Tod hat er zu seinem Lebensthema gemacht.
Im Pflegeheim begegnet er Tessa, einer Frau Anfang 50, die gerade kurz nacheinander beide Elternteile verloren hat. In ihrer Trauer befasst sich Tessa mit der Sinnfrage:
Der enorme Aufwand eines Lebens zerrann im Nichts. Im Nichts von beseelten Ausweisen, hinfälligen Diskussionen, Hausrat, Fotos, Korrespondenz, Kleidung, Büchern. Die Salatschüssel aus Sizilien.
Erzählt wird der Roman aus der Perspektive von Jean Tobelmann, einem Jugendfreund von Tessa. Er führt ein Restaurant und wäre eigentlich lieber Schriftsteller geworden. Bei gemeinsamen Besuchen von Tessa und Sourie in diesem Restaurant wird aus der Begegnung eine Freundschaft und aus der Freundschaft eine Liebesbeziehung. „Du kannst dir nicht vorstellen, Jean, was sie in mir auslöst“, schwärmt Sourie eines Abends in Jeans Restaurant.
Sie ist die erste Frau, die mich nicht langweilt. Sie ist umwerfend, klug. Interessiert. Für sie ist alles Hingabe, nichts geschieht beiläufig. Sie spielt keine Spielchen, sie ist. In all ihrer Traurigkeit ist sie zupackend, selbst ihre Trauer nimmt sie in die Hand. Es ist, als würde sie backen. Sie vergisst keine Zutat, knetet und walkt die Traurigkeit.
Als Jean Tessa fragt, wann alles begann, wann genau sie sich in Sourie verliebt habe, sagt sie: „Es war mir nicht bewusst, aber es war der Blick von der anderen Seite, eine Perspektive, die man nur mit ihm gewinnen konnte.“
Sourie hat keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil, der Tod fasziniert ihn wie nichts sonst. Ständig redet und philosophiert er darüber in seiner heiteren lebensfrohen Art. So bringt er Leichtigkeit in Tessas Leben. Mit ihm stiehlt sie sich aus der Zeit. Er stellt Romantik vor ihre Tür. Sie empfindet denselben Reiz, dasselbe Verlangen wie früher, nur schamloser, klarer, überlegter. Und obwohl ihr die Verrücktheit der Beziehung bewusst ist, da Sourie ihr Sohn sein könnte, lässt sie sich darauf ein – „tatkräftig und glücksgewillt“.
Sourie und Tessa entwickeln ein Projekt, mit dem sie im Pflegeheim offene Türen einrennen. Sie nennen es „Projekt gegen die Einsamkeit“. Sie besuchen die Bewohner auf ihren Zimmern, reden mit ihnen über ihre Lebensgeschichten, wollen von ihnen lernen und ihnen die Zeit vertreiben, nur eine Tür von der „anderen Welt“ getrennt. Die „andere Welt“, die es nicht mehr gibt: Das erinnert Tessa an ihre Eltern, als sie im Pflegeheim eingezogen waren, weil es zuhause nicht mehr ging. Es wurden Koffer gepackt – ein, zwei, denn mehr Platz hat dein Leben nicht mehr. Der Rest bleibt sinnentleert zurück in einem unbehausten Domizil.
Bei einem dieser Einsamkeitsbesuche erfährt Tessa das erste Mal von Thibault. Thibault war Souries bester Freund. Vor sieben Jahren hatten beide gemeinsam den Pariser Musikclub Bataclan an jenem Abend besucht, als viele Menschen bei einem Terroranschlag starben. Auch Thibaut. Seither trägt Sourie die Frage mit sich herum, warum Thibault und nicht er ums Leben kam.
Das Ende von Tessas und Souries Beziehung kommt zweifach erst vorläufig, dann endgültig. Tessas Mann „erwischt“ die beiden im Aufzug des Pflegeheims. Jetzt braucht Tessa eine Pause und will eine Weile in Ruhe gelassen werden. Sourie zieht sich nach Norwegen zurück. Dort stirbt er unerwartet an einem angeborenen Herzfehler. Als Tessa von Souries Tod erfährt, plagt sie Schuld: Hätte sie seinen Tod verhindern können?
Für Jean Tobelmann, die Erzählfigur des Romans, war Sourie ein offenes Buch. Gleichzeitig blieb er für ihn ein großes Rätsel. Souries todesumarmende Gelassenheit fand Jean suspekt. Er nötigte ihn, ständig über den Tod zu sprechen. Nach seinem Tod lässt er ihn an nichts anderes mehr denken. So taucht Jean tiefer ein in Souries Leben und lüftet das Geheimnis um Thibault. Darüber kommt Jean zu dem Schreiben, von dem er immer geträumt hatte.
Husch Josten erzählt von Vergänglichkeit und Lebenslust, aber auch von Liebe und Freundschaft, eben von der Gleichzeitigkeit der Dinge. Die meisten Menschen schweigen oder verdrängen das Thema Tod, weil sie Angst haben und nicht wissen, was auf sie zukommt. „Die größte Zumutung unseres Lebens ist zu wissen, dass wir sterben“, sagt Husch Josten. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, daher muss ich eine Haltung dazu finden.“
Dieses Buch hat mich gefesselt, weil es mir meine eigenen Erfahrungen mit Endlichkeit und Tod vor Augen führte. Als junge Frau fühlte ich mich unsterblich. Der Tod meiner Eltern zeigte mir, dass es irgendwann zu Ende geht und ein Mensch einfach weg sein kann. Wie im Roman die Salatschüssel aus Sizilien sind plötzlich unzählige Dinge, die vorher eine Bedeutung hatten, nur noch ein Fall für den Wertstoffhof.
Es ist ein tiefgründiges und heiteres Buch zugleich, bei dem es auch um die Liebe und das Leben geht. Man kommt anders aus dem Buch, als man hineingegangen ist. Es lässt einen gelassener auf den Tod schauen.
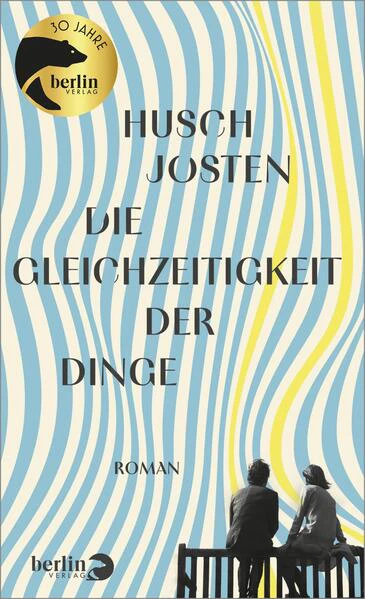
Husch Josten: Die Gleichzeitigkeit der Dinge. Berlin, München: Berlin Verlag 2024, 223 Seiten, 22 Euro.
Husch Josten studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Sie hat bereits mehrere Romane geschrieben und zahlreiche Auszeichnungen bekommen.
Nach einer langen Managementkarriere widmet sich Sabine Keuschen ihrer Leidenschaft für Literatur und arbeitet in einer Buchhandlung.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus