

Vor einigen Wochen half ich einer Freundin bei ihrem Umzug aus ihrem Haus in eine kleinere Wohnung. Verbunden damit war natürlich, sich von Dingen zu trennen. Als wir beim Bücherregal ankamen, fiel mir ein Buch in die Hände, das sie doppelt hatte und das bereits 2017 erschienen war – es wurde zu meinem Buch auf der Zugfahrt zurück nach Hause. Schon seit langem interessieren mich Themen wie Heimat und Zuhause. Wo und wie möchte ich leben? Nur wenige Monate vorher hatten mich diese Fragen aufgewühlt, als wir nach dem Tod meines Vaters das Haus meiner Eltern leerräumten.
Das erbeutete Buch: „Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen“ von Daniel Schreiber. Ein persönlicher Essay über einen Ort, nach dem wir uns sehnen. Schreiber beleuchtet diesen Ort aus verschiedenen Blickwinkeln: philosophisch, psychologisch und soziologisch. Dabei erzählt er die Geschichte von Flucht, Vertreibung und Entwurzelung seiner Familie. Er berichtet über seine eigene Geschichte, die eines schwulen Jungen in einem mecklenburgischen Dorf. Über die Ausgrenzung, die er im Kindergarten, in der Schule und im System DDR erfahren hatte, in dem jede Form von Andersartigkeit eine Bedrohung darstellte.
Während seiner Lebenskrise und Sinnsuche lebt er in Berlin, London und New York und begegnet hier Menschen, bei denen er lernt, was Beziehung bedeutet. Er ist auf der Suche nach einem Zuhause, um sein Bedürfnis nach Sicherheit und die Antwort auf die Frage zu finden, wie und wo er eigentlich leben will. Dabei geht es nicht nur um den Ort, sondern um die Menschen, mit denen der Ort verbunden ist – „der Ort, in dem wir nicht in Frage gestellt werden“.
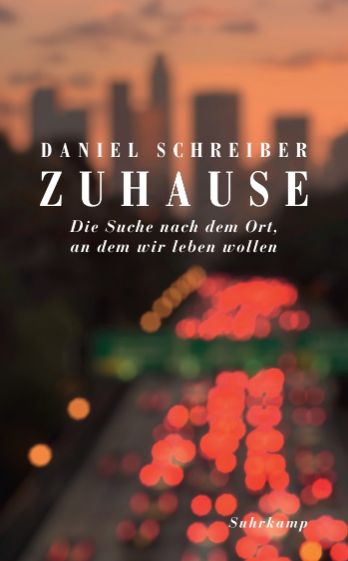
Dieses sehr persönliche und ehrliche Buch hat mich berührt. So war ich sensibilisiert, als mir wenige Tage später ein aktuelles Buch in die Hände fiel: „Wohnen“ von Doris Dörrie. Dieser Essay der Filmemacherin und Autorin beginnt mit den Erinnerungen an eine schöne Kindheit in Hannover. Der Vater war Kinderarzt, die Mutter erledigte seine Buchhaltung und umsorgte die Familie mit vier Kindern. Das Zuhause der Kindheit – oder die Erinnerung daran – ist meist ein geschützter Ort, behütet und spielend in den Tag zu leben. Als Schulkind hatte die Erzählerin bereits ein eigenes Zimmer, in dem sie lesen und schreiben konnte, ein Mädchenzimmer mit einer Märchentapete. Alle anderen Räume waren weiß mit Raufaser tapeziert. Wenn den Kindern langweilig war, pulten sie die kleinen Erhebungen der Raufaser Stück für Stück ab. Doris Dörrie erinnert sich an ihr Puppenhaus oder daran, wie sie die Welt an der Reckstange im Garten kopfüber anschaute und wie sie sich später, als sie längst ausgezogen war, nach der frisch gewaschenen und gebügelten Bettwäsche zurücksehnte.
Die Küche war Ort der Versorgung, des Essens, aber auch des Austausches. Die ganze Welt wurde am Esstisch erklärt und diskutiert: endlose politische Diskussionen. Es wurden pikante Geschichten über Nachbarn oder Verwandte ausgetauscht.
Am Esstisch lernten wir, zu erzählen – es galt, eine potenziell bösartige und feindselige Welt da draußen in eine gute Geschichte hier drinnen zu verwandeln.
Doris Dörrie thematisiert mit feministischem Blick die Küche als den Raum für die Frau, die sonst keinen eigenen Raum hatte – ein komplexer Raum vornehmlich weiblicher Anerkennung und Abwertung. Dabei schildert sie ihre Wahrnehmung der Mutter, die immer da war und sich als Versorgerin der Familie, aber auch als Managerin, als moderne Frau mit den vier Kindern verstand.
Früh zog Doris Dörrie aus, um in New York zu studieren. Weil sie kein Zimmer fand und wenig Geld hatte, lebte sie zeitweise in einer Obdachlosenunterkunft, in der es von Kakerlaken nur so wimmelte und die Matratze vollgepinkelt war. Sie reiste gerne und viel und lebte in Kalifornien und Mexiko. Oder auf einem Bauernhof in Bayern. Die Orte, an denen sie wohnte, wählte sie eher absichtslos. Lange Zeit hatte sie keinerlei Sehnsucht nach einer eigenen Wohnung und lebte in Wohngemeinschaften. Wie von einem zweiten Zuhause schwärmt sie noch heute von Japan, wo die Wohnungen kleiner sind und eine besondere Atmosphäre ausstrahlen. Man sitzt und schläft auf dem Boden auf Tatamis – es wird anders gewohnt in Japan als in Deutschland.
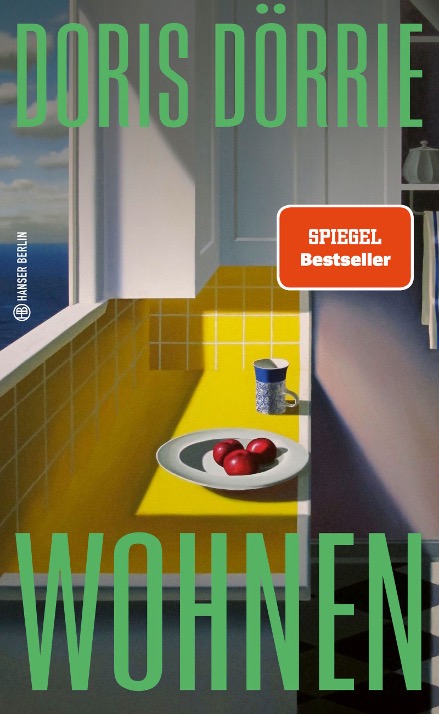
Welche Bedeutung hat die Traumwohnung, das Traumhaus? Warum geben wir so viel Geld für das perfekte Nest aus, in dem das Glück stattfindet, in dem wir frei sein können wie im Paradies? Doris Dörrie beschäftigt sich mit der Frage, wie sehr wir Wohnmuster in uns tragen als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Wohnungen sind Metaphern. Sie erzählen immer über uns, von welcher Umgebung wir beeinflusst werden und welche Umgebung wir beeinflussen.
Wohnen und Identität sind eng miteinander verbunden. Wir verbringen Jahrzehnte damit, Dinge anzuhäufen, die uns Halt geben, mit der Welt verbinden, uns erfreuen oder Status verleihen. Am Ende des Lebens bleibt uns das große Aufräumen nicht erspart, und wenn wir es selbst nicht mehr schaffen, müssen es andere für uns tun.
Doris Dörrie hat ein kluges Buch geschrieben über ihre Wohngeschichten. Beide Bücher, „Wohnen“ und „Zuhause“, verbindet die Suche nach dem inneren Ort, dem Nest, an dem wir mit Menschen verbunden sind und frei sein können.
Daniel Schreiber: Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Suhrkamp Taschenbuch 2018, 140 Seiten, 12 Euro.
Doris Dörrie: Wohnen. Berlin: Hanser 2025, 128 Seiten, 20 Euro.
Nach einer langen Managementkarriere widmet sich Sabine Keuschen ihrer Leidenschaft für Literatur und arbeitet in einer Buchhandlung.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus