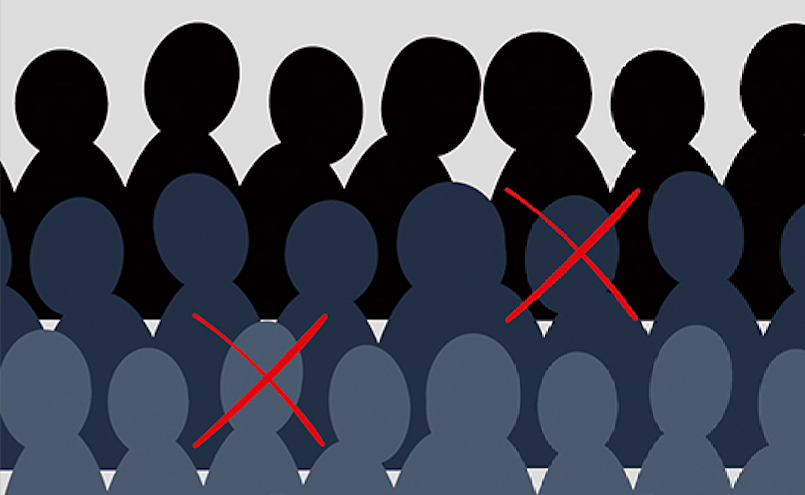
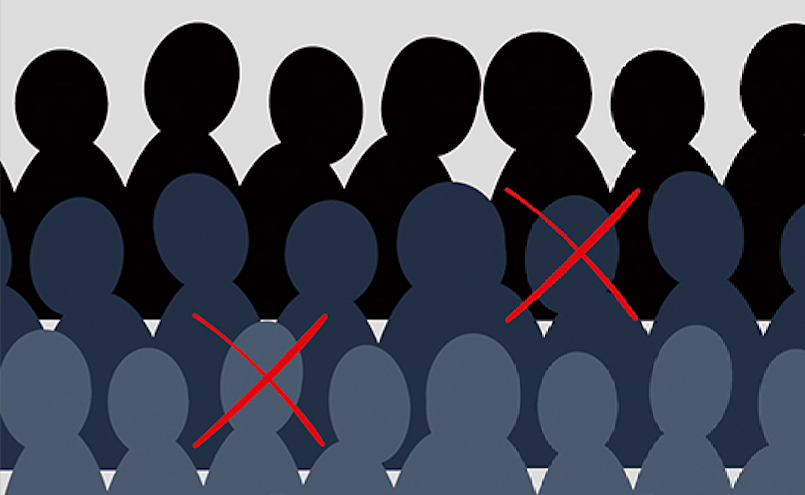
Das mit dem Foto war schwierig. Wollen wir das wirklich machen? Erkennt irgendeine KI inzwischen vielleicht selbst die, die sich ein Buch vor das Gesicht halten? Es gibt das Foto, geschossen am Montag in Neu-Isenburg vom Pressemann des Verlags. Elf Professoren, die entlassen oder degradiert worden sind. Es war noch eine zwölfte Kollegin dabei, aber nicht jeder mag in die Öffentlichkeit, selbst dann nicht, wenn man inzwischen weiß, dass es nicht an einem selbst gelegen hat.

Es ist gut, dass es dieses Bild gibt. So bekommt das Problem ein Gesicht. Im Buch stehen nur zwei Namen – neben meinem der von Ulrike Guérot, hier rechts neben den Autorinnen. Wir kamen in einem Spiegel-Artikel vor, der es bei Heike Egner und Anke Uhlenwinkel in eine Zwischenüberschrift geschafft hat: „Das Prof.-Kokolores-Narrativ“. Dazu gleich mehr.
Wichtiger ist zunächst die Geschichte, die Egner und Uhlenwinkel erzählen. Wenn ein Professor entlassen wird, dann ist das kein „unglücklicher Einzelfall“. Die beiden sagen zwar, dass es „eigentlich jeden treffen“ könne (S. 84), der Vogelblick auf die 60 Biografien, auf die sie sich stützen, belegt aber das Gegenteil. Es trifft vor allem Aufsteiger – Menschen, die an das humboldtsche Universitätsideal geglaubt und es aus eigener Kraft auf eine Lehrkanzel geschafft haben, ohne die Protektion eines Milieus, das ganz selbstverständlich immer wieder Minister und Richter, CEOs und eben auch Professoren hervorbringt und dabei ganz nebenbei auch all die kleinen Kniffe, Formeln, Regeln vererbt, die jeder kennen muss, der wirklich dazugehören und so auch dabeibleiben möchte. 60 Menschen, okay. Immer noch 60 Einzelfälle, aber zu viele, um übersehen zu können, dass es vor allem Frauen trifft und Kinder aus Familien, die nie etwas mit der Universität am Hut hatten, im Wortsinn „gute“ Wissenschaftler (bereit und in der Lage, alles zu tun, was Reputation einbringt) und im Zweifel eher Ältere, aus Geburtsjahrgängen, die erst Humboldt gehört haben und dann Bologna.
Ich kannte diesen Befund schon und wusste auch, dass das „Phänomen“ Professorenentlassung seit 2018 „deutlich sichtbar an Fahrt aufgenommen hat“, wie das Heike Egner und Anke Uhlenwinkel formulieren (S. 19), so neutral wie möglich und mit einer Distanz, die jedem Bewunderung abringt, der ihre persönliche Geschichte kennt. Ich wusste auch, dass es zunächst, ab den Nullerjahren, eher um Mobbing ging, um den Schutz von Nachwuchsforschern und ähnlich schwer fassbare Argumente und dass die Öffentlichkeit so schon vorbereitet war auf das, was 2021 begann und im Buch „ideologische Unbotmäßigkeit“ genannt wird (S. 48). Genderfragen, Migration, Pandemiepolitik, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza. Der Montag im Verlag hat dieser Gemengelage Leben eingehaucht. Am Kaminfeuer hat jeder in ein paar Minuten skizziert, was passiert ist. Unfassbar, das alles, vor allem, wenn man spürt, wie sich der Absturz und die Kämpfe, die zum Teil schon länger als ein Jahrzehnt dauern und manchmal immer noch nicht ausgestanden sind, in Geist und Körper gefressen haben und auch vor den Partnern nicht Halt machen.
Ihre Studie sei „wie ein Brennglas“, schreiben Heike Egner und Anke Uhlenwinkel, durch das man „das Ende“ viel besser erkennen könne (S. 28) – in erster Linie das Ende einer Wissenschaft natürlich, die in jeder Hinsicht unabhängig ist, „der Suche nach der Wahrheit“ genauso verpflichtet wie der Werturteilsfreiheit (S. 14) und sich immer darüber im Klaren, dass wir morgen mehr wissen oder etwas ganz anderes. Auf eine Formel gebracht: „keine Kontroverse, keine Wissenschaft“ (S. 27). Das „Ende“ ist allerdings, wie sollte es in so einem Buch anders sein, viel größer. Die Diagnose zielt auch auf eine Generation, die gelernt und dann lange geglaubt hat, dass sich Leistung lohnt, und nun auf Schulen schaut, die „Sach- und Fachinhalte“ für verzichtbar halten, stattdessen „Kontaktpflege-Kompetenzen“ belohnen und damit den „alten Eliten“ helfen, die genau das den Ihren gewissermaßen im Schlaf mitgeben (S. 43). Er zielt auf die Identitätspolitik, die den „Hauptwiderspruch“ verdeckt („das Klassenverhältnis als Ursache sozialer Ungleichheit“, S. 35) und sich stattdessen an Nebenwidersprüchen abarbeitet. Und er zielt auf den Journalismus, mein Fachgebiet. Wer Fälle aus einem Vierteljahrhundert vergleichen kann, der sieht, was sich hier verändert hat – von der Kritik an Universitäten und Hochschulpolitik in den Nullerjahren, als der Glaube an eine „vierte Gewalt“ selbst in den Redaktionen noch allgegenwärtig war, über die Moralisierung nach der Machtübernahme durch die Plattformen in den 2010ern (Stichwort: böse alte Männer, böse weiße Frauen) bis zur Kokolores-Propaganda spätestens ab Frühjahr 2020. „Es scheint, als müssten wir Gesellschaft neu erfinden“, schreiben Egner und Uhlenwinkel etwas ratlos auf der letzten Seite (S. 86).
Die Verbeamtung, das wurde am Montag in diesem kleinen Kreis der Ausgestoßenen schnell klar, sollte unbedingt in die neue Zeit getragen werden. Gerd Morgenthaler, ein Jurist, nennt das in seinem Vorwort die „vielleicht letzte Bastion“, wenn man „echte Wissenschaftsfreiheit“ verteidigen wolle (S. 8). Ich zitiere das anstelle eines Schlussworts:
Diese Vorkehrung dient nicht dazu, den Wissenschaftler zum Teil der hoheitlichen Staatsverwaltung zu machen. Vielmehr hat sie den Sinn, dem einzelnen Forscher durch die Garantie einer Beschäftigung auf Lebenszeit und eines festen Gehalts die innere Freiheit zu schenken, die für die allein der Wissenschaft verpflichtete Institution Universität im humboldtschen Sinne nun einmal unverzichtbar ist.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus