

Spätestens als sich Corona-Maßnahmen-Protestierer und neue Antifa gegenüberstanden und sich gegenseitig „Nazis raus!“ entgegenriefen, war klar, dass die gesellschaftspolitischen Definitionen nicht mehr passen. Die Juristin, Naturheilärztin und Musikerin Lisa Marie Binder erarbeitet in ihrem Buch Der Super-Faschismus eine neue Definition für den Begriff „Faschismus“. Sie zeigt auf, wie sich dieser Faschismus aus dem totalitären Wirken bestimmter Kreise im Zusammenhang mit der sogenannten Pandemie entwickelt hat. Sie beschreibt die juristischen Zusammenhänge auf dem Weg von der Aussetzung elementarer Grundrechte bis zur Etablierung der „Neuen Normalität“. Indem wir diese Zusammenhänge erkennen und benennen, machen wir uns auf den Weg, Frieden zu finden.
In ihrem Vorgänger-Buch Der Rechts-Befund hat Lisa Marie Binder eine Analyse der juristischen und gesellschaftspolitischen Verwerfungen in Deutschland ab 2020 dargelegt. Auf dieser Basis untersucht sie in Super-Faschismus anhand von Begriffs-Definitionen und den gesetzlichen Regelungen dieser Zeit, inwiefern es sich dabei um Demokratie, Diktatur, Totalitarismus oder Faschismus handelt.
Ihr Befund: Die Regierung agierte diktatorisch, und die Demokratie wurde dadurch von totalitären Tendenzen durchwoben. Denn mit dem „Infektionsschutzgesetz“ waren alle Lebensbereiche dem politischen Willen unterworfen. Aber es blieben Ausnahmen und Lücken, wenn Menschen sich widersetzten, sich zum Beispiel trotzdem trafen und ohne Strafe davonkamen. Binder stellt fest: „Beide [Diktatur und Totalitarismus] entwickeln sich aus der Natur des Menschen, und zwar immer dann, wenn Machtstreben menschliche Ethik überragt.“
Die Gesetzeserlasse waren nach ihrer Analyse eine Schädigung der Demokratie mit bedingtem Vorsatz. Denn die Warnungen der außerparlamentarischen Opposition wurden nicht nur nicht gehört, sondern aktiv unterdrückt. Alle Meinungen anzuhören und in einem Austausch der Argumente den besten Weg zu finden, ist aber die Basis der Demokratie. Der bedingte Vorsatz der Demokratieschädigung wäre in einem Strafprozess geeignet, die Strafbarkeit der Täter zu begründen.
Lisa Marie Binder geht mutig der Frage nach, ob der antidemokratisch und diktatorisch wirkende Staat der bestehenden Definition für Faschismus entspricht. Dabei orientiert sie sich an Rudolph Bauer:
Die Erkenntnis, dass der Faschismus auch eine andere Form als die historisch überlieferte annehmen kann, ist mental und intellektuell nicht leicht nachvollziehbar. Sie erfordert intellektuellen Mut und Redlichkeit.
Binder stellt fest, dass die „neue Normalität“ bestimmte Merkmale der Faschismus-Definition wie Nationalismus, Rechtsradikalität und Führerprinzip nicht aufweist. Während aber der Totalitarismus neben gewaltvollen Aktionen und Schikanen oppositionelle Meinungen noch aushalten kann, kommt im Faschismus das fanatische Element hinzu. Die Umsetzung der Gesetzgebung folgte einer Ideologie, mit der die komplexen Sachverhalte vereinfacht und politische Positionen gerechtfertigt wurden. Kern der Ideologie war das Primat der Volksgesundheit vor den Belangen und Grundrechten des Einzelnen. Wesentlich und unverzichtbar für den Faschismus sei die Intoleranz gegenüber dem Abweichen des Einzelnen von der vorgegebenen Richtung. Wir alle erinnern uns an den Satz von Lothar Wieler: „Diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden.“
Fanatische Elemente fanden sich in den gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen. Wenn zum Beispiel Angehörige beim Sterben allein gelassen werden mussten. Oder wenn Kinder in Quarantäne in ihr Zimmer gesperrt wurden und nur das Essen vor die Tür gestellt bekamen. Damit wurden die engsten persönlichen Bindungen in einer bisher nicht gekannten Grausamkeit aufgelöst – alles unter dem Label „solidarisches Verhalten“. Diesen Zugriff auf den Kern des Menschen, auf seine Seele, identifiziert Lisa Marie Binder als einen der Gründe, warum wir es mit einem „Super-Faschismus“ zu tun haben, der über alle bisherigen Ausgestaltungen des Faschismus hinausgeht.
Faschismus produziert Menschen, die keinen Widerspruch mehr leisten, weil sie Nachteile für sich vermeiden wollen oder nicht aushalten können. „So wird dieser Mensch, geplagt von seiner tiefen Angst, selbst zum Faschisten.“ Die Angst ist der zentrale Anker für eine faschistische Entwicklung. Dabei ist der primäre Grund für die Angst nicht entscheidend – Krankheit, Tod, Krieg oder Klimakatastrophe. Entscheidend ist die Befolgung des einen, richtigen Erzählstrangs. Auf diese Weise „das Richtige“ tuend, verschwindet die Angst vor dem Ausschluss aus der Gruppe beziehungsweise der Gesellschaft – die Urangst des Menschen.
Die Erkenntnis, dass die gesetzlich verordneten Maßnahmen in einen Wahn mündeten, der auf den Kern des Menschseins zielte, muss jeder mit seinem eigenen ethischen Werte-System abgleichen. Aus dieser Bewusstseinsarbeit kann innerer Friede folgen, der nach außen getragen werden kann.
Binder schreibt in einem klaren, fesselnden Stil und einer präzisen Sprache. Das Buch ist allen zu empfehlen, die sich mit den Geschehnissen seit 2020 beschäftigen. Es ist wichtig, die Grausamkeiten der Gesetzgebung dieser Zeit in Gänze zu verstehen und mit den passenden Definitionen zu versehen, um zukünftige Entwicklungen in der gleichen Richtung zu verhindern.
Lisa Marie Binder stellt ihr Buch Der Super-Faschismus bei einer Lesung in der Reihe „Der andere Blick“ in Leipzig vor: 21. Juni 2025, 19 Uhr, Theaterkeller des Gwuni Mopera, Sternwartenstraße 4-6
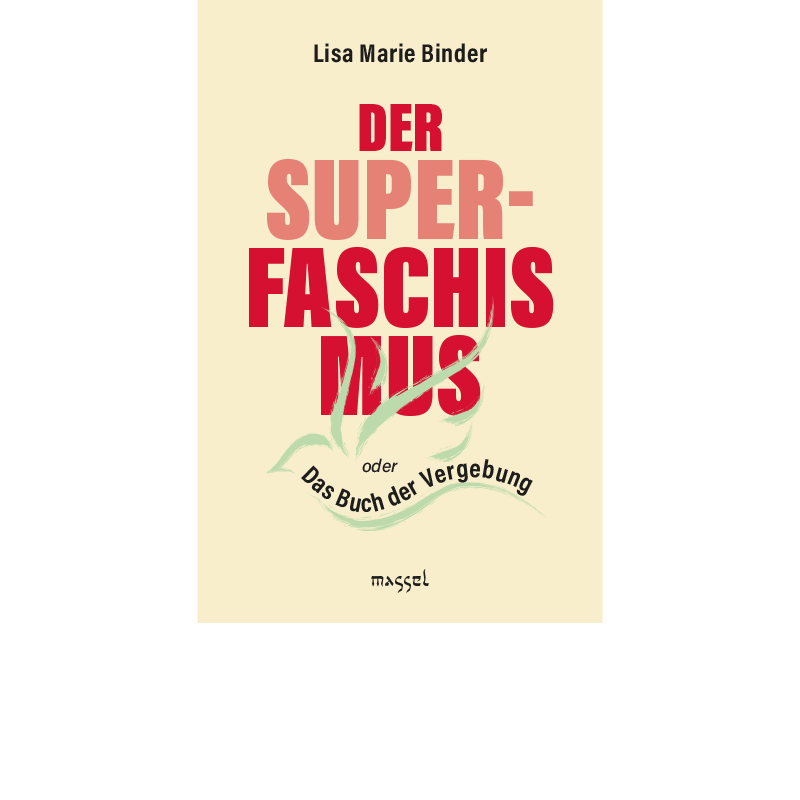
Lisa Marie Binder: Der Super-Faschismus oder Das Buch der Vergebung. München, massel Verlag, 2024, 220 Seiten, 20 Euro.
Beate Strehlitz ist promovierte Diplomingenieurin in Rente und hat 33 Jahre als Wissenschaftlerin in einem Forschungszentrum gearbeitet. Sie hat an mehreren Kursen der Freien Akademie für Medien & Journalismus teilgenommen.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus