

Ob ein Roman etwas taugt, merkt man oft erst mit etwas Abstand. Autor, Rezensenten, Leser: Wir alle sind gefangen in Kämpfen und Emotionen, die zu einem Ort gehören und zu einer Zeit. Jahre später und erst recht bei einem Umzug blickt man dann mit einem leichten Erstaunen in sein Regal und fragt sich, warum man diese Schwarte aufgehoben hat oder jene. Langweilig, verstaubt und im Wortsinn aus Raum und Zeit gefallen.
In meinem Schrank steht jetzt ein Buch, fast ein Vierteljahrhundert alt, das genau das zum Thema macht und so das Zeug hat, uns alle zu überdauern. Genauer: Jörg Bernig schreibt über ein Dorf und über ein paar Monate, die es nicht gegeben haben kann – oder vielleicht doch. Er schreibt über die Sehnsucht, von vorne anfangen zu können und dabei alles hinter sich zu lassen, was in das kollektive Gedächtnis eingebrannt worden ist von einer Macht, die zwischen UNS und IHNEN unterscheiden will und muss und damit auch gesteuert hat, was wir bisher getan und erlebt haben und damit für das halten, was wir sind.
Und damit hinein in die Niemandszeit der Jahre 1945/46, in einen Ort zwischen Gablonz, Zittau und Oybin, noch im Böhmischen, aber nicht auffindbar für die Revolutionsgarde, die alle über die neue Grenze schickt, die nun nicht mehr hierhergehören sollen, und nicht viel Federlesens macht mit denen, die gerade noch auf der Sonnenseite zu stehen schienen oder nicht verstehen können, dass sich der Wind gedreht hat. Tief in den Wäldern finden sich die, die ausscheren hier und dort. Tschechen, die ein schlechtes Gewissen haben oder sonstwie genug vom Schreien, Schlagen, Morden. Deutsche, die auf die eine oder andere Weise nicht bereit sind für den Marsch ins Ungewisse. Alte und Junge, die zwar ihre Geschichte und ihre Geschichten mitbringen, aber offen sind für die anderen, weil sie all das hinter sich gelassen haben, was Wissenschaftler Meinungsklima nennen. Menschengemacht und Motor für alles, was Menschen einander antun. Wir selbst mögen in dem Kerl da drüben zwar den liebevollen Vater sehen, den geschickten, attraktiven Mann oder den Veteranen, der in Kriege gezwungen worden ist, die nicht die seinen waren, wir wissen aber zugleich, wie die Macht diesen Typ gerade zeichnet und was Nachbarn, Freunde, Mitmenschen folglich von uns erwarten – ob sie wollen oder nicht.
Bei Jörg Bernig hat diese Macht keinen Namen. Ein Präsident, der im fernen Prag Dekrete schreibt. Ein Wachtmeister und junge Männer, die sich bei ihm verdingt haben und stolz darauf sind, dass sie nichts, aber auch gar nichts auslassen bei den Säuberungen. Der Jäger, der ihnen immer ein paar Stunden voraus ist, um die Gegend zu erkunden, bekommt erst dann ein Gesicht, als er zum Liebenden wird – zu einem Mann, der nach Theres sucht, einer Deutschen, der er sich versprochen hatte, als das schon nicht mehr schicklich war, und deren Vater ihn deshalb in das Lager schicken ließ, das ihn zum Jäger werden ließ. Diese Theres ist nun, so will es der Plot, in jenem Dorf, das aus der Zeit gefallen ist – ohne Namen, versteht sich, wieder mit einem tschechischen Mann, aber wie der Jäger, ihr Ex, immer auf der Suche nach einer Vergangenheit, die nicht mehr zurückzuholen ist, auch in Gablonz nicht, wohin sie sich auf langen Spaziergängen schleicht.
Ich war als Kind oft in Jablonec und Liberec und wusste nichts von alldem, was Jörg Bernig da wieder aufleben lässt. Ich habe mich über die Gastfreundschaft gefreut und darüber, dass viele Einheimische Deutsch konnten. Die Vertreibung und ihre Vorgeschichten waren kein Thema in der DDR – oft selbst bei denen nicht, die das alles erlebt und erlitten hatten. Wer wollte darüber reden mit Unbekannten, wenn es in den Lehrbüchern keine Verweise gibt und in der öffentlichen Sprache keine Formeln und keine Begriffe? Ich habe gelesen, dass Jörg Bernigs Familie aus Böhmen stammt und dass er selbst, geboren 1964, als Kind und Jugendlicher oft dort gewesen ist, wo sein Vater einst „zu Hause“ war. Vielleicht braucht es diese Mischung aus Betroffenheit und Distanz, um etwas zu schaffen, was über Zeit und Ort hinausweist und genauso in Ostpreußen spielen könnte, in Siebenbürgen, in Afrika oder im Hier und Jetzt, wenn die einen gegen die anderen aufgehetzt werden und es kein Morgen zu geben scheint, das ein Miteinander denkbar macht.
So ein Roman lebt auch von den Figuren, vom Knistern in den Beziehungen und von dem, was zwischen Mann und Frau passiert. Bei Jörg Bernig kommt eine Sprache dazu, die einen Sog erzeugt, dem man sich nur schwer entziehen kann. Ein Appetithappen, der sich leicht anwenden lässt auf die Mechanik von Corona und anderer Cancel-Kulturen:
Die bloße Existenz ihres Ortes, so weit nun schon zurückreichend in die Zeit nach dem Krieg, mußte ein Stachel im Fleisch der Revolutionsgarde sein. Daß sie gemeinsam lebten im letzten Ort der Welt mit aufrecht erhaltenen Absprachen, die es jedem erlaubten zu sein, wer er war, das war der gefährlichste Angriff nicht nur auf die Männer der Revolutionsgarde oder den Wachtmeister, sondern auch auf den, der die Gesetze unterschrieben hatte, die dem Wachtmeister und seinen Leuten freie Hand ließen und das Versprechen einer nie einzufordernden Rechtfertigung gaben. Indem den Revolutionsgardisten versprochen wurde, daß es kein Fragen und Antworten geben werde, wurde ihnen ein Raum vorgetäuscht, der nie Geschichte werden würde, der schon im Moment des Sich-Ereignens ohne Geschichte war, vergessen von Anfang an und in alle Ewigkeit. Diese Sicherheit der Geschichtslosigkeit war es, aus der sie ihre Unangreifbarkeit bezogen (S. 265).
Wer noch zweifelt, ob er das lesen soll: Die stärkste Figur ist ein kleiner Junge, der in jeder Hinsicht aus dem Rahmen fällt. Mit Glück und Elterngeschick den Euthanasieanstalten entkommen, verzückt er die Menschen an diesem unwirklichen Ort, weil er mehr sehen kann als sie und vielleicht dafür gesorgt hat, dass Jörg Bernig dieses wundervolle Buch schreiben konnte.
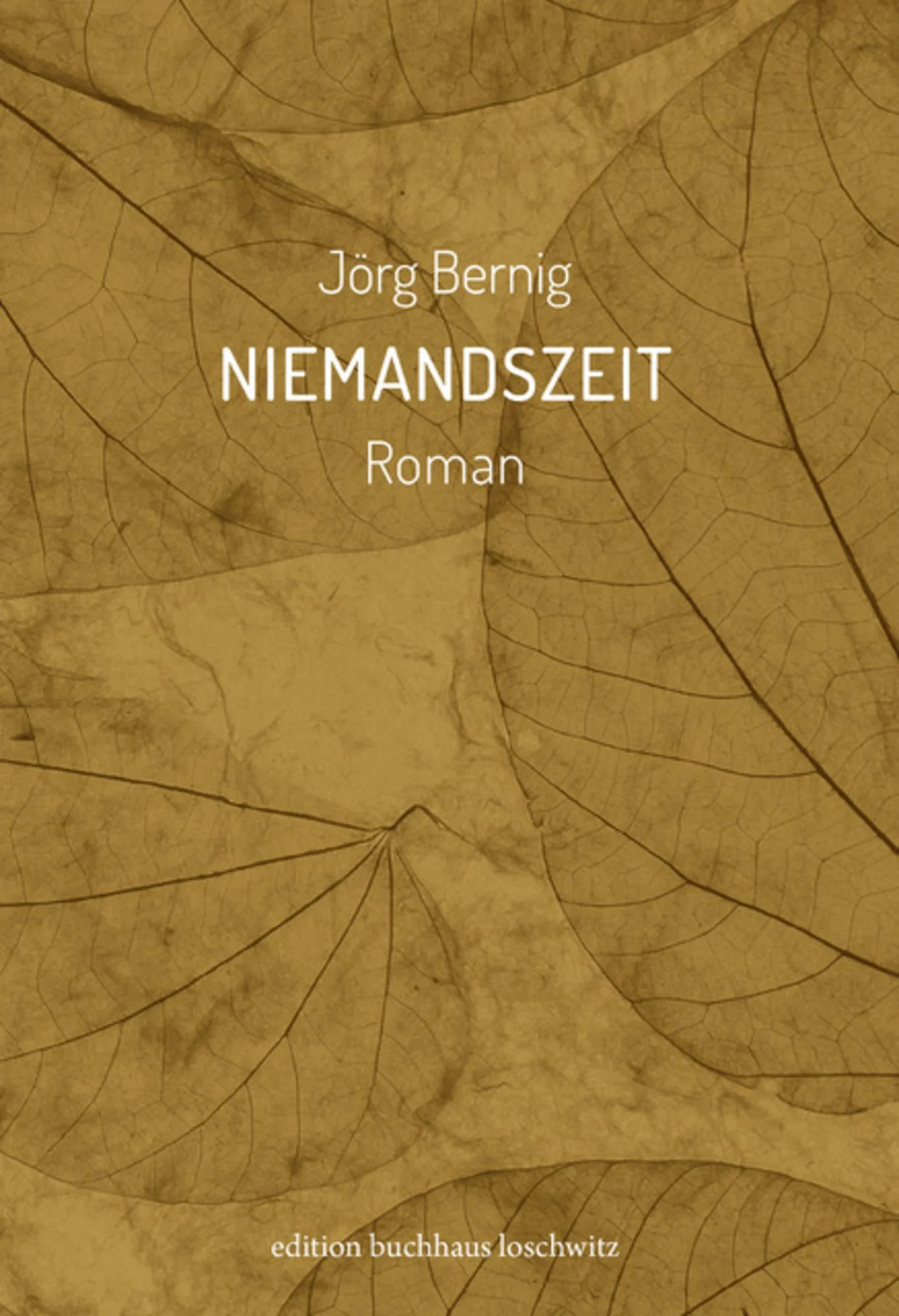 Jörg Bernig: Niemandszeit. Roman. Dresden: Edition Buchhaus Loschwitz 2020 (Erstauflage München: DVA 2002), 327 Seiten, 20 Euro.
Jörg Bernig: Niemandszeit. Roman. Dresden: Edition Buchhaus Loschwitz 2020 (Erstauflage München: DVA 2002), 327 Seiten, 20 Euro.
Newsletter: Anmeldung über Pareto