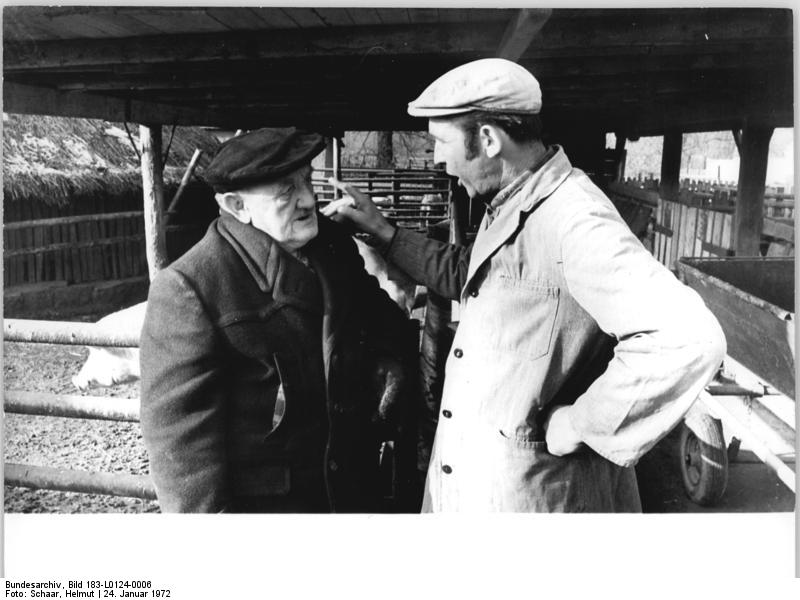
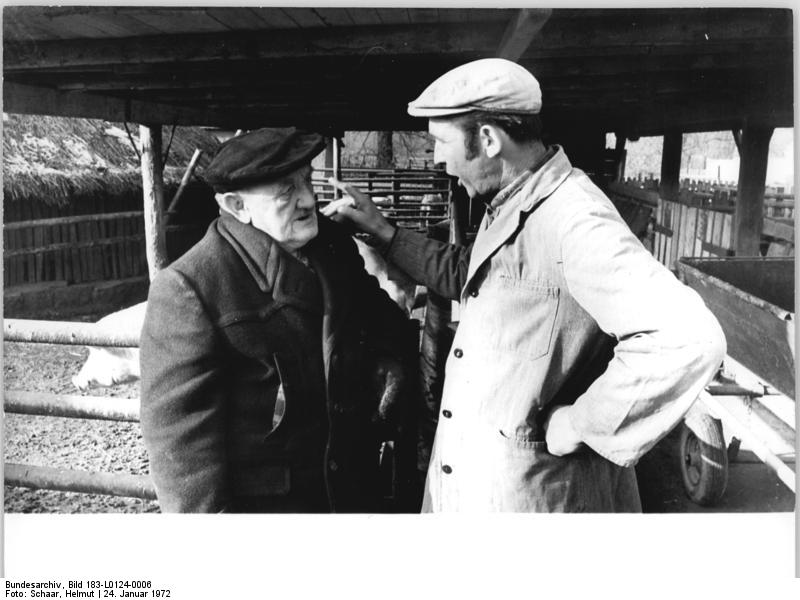
Müssen wir mehr arbeiten? Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Ja, meiner Meinung nach müssen wir das.
Allerdings ist die Wochenarbeitszeit, die dabei meist im Blickfeld liegt, das kleinste Problem. Natürlich sind acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche weder in die eine noch in die andere Richtung gottgegeben, auch wenn es dafür etwa im Dreischichtbetrieb viele praktische Gründe gibt. Aber wir leben nicht mehr in Zeiten der Frühindustrialisierung mit zerstörerischen Arbeitszeiten selbst für Kinder. Bei einer Fünftagewoche mit acht Stunden pro Tag ergibt sich eine Arbeitszeit von 1.680 Stunden pro Jahr. Tatsächlich beträgt die durchschnittliche Vollzeitarbeitszeit nur 1.588 Stunden. Dies sind 19,2 bzw. 18,1 Prozent der 8.760 Stunden, die ein Jahr umfasst. Rechnet man den Teilzeiteffekt mit ein, dann beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit 1.349 Stunden pro Jahr, also nur 15,4 Prozent der „Jahreslebenszeit“. Und auch das betrifft nur die rund 37 Jahre, die Menschen in Deutschland im Durchschnitt arbeiten – bei einer Lebenserwartung von rund 80 Jahren.
Was eigentlich soll angesichts solcher Zahlen das Ziel weiterer Arbeitszeitverringerung sein, wie sie vor zwei Jahren die IG Metall forderte? Jedenfalls fiel der IG-Metall selbst nichts anderes zur Begründung ein außer der deprimierenden Erklärung, dass eine Stunde weniger Arbeit eine Stunde mehr Leben sei. Bisweilen hilft ein bisschen Marx: Nach seiner Vorstellung reduzierte ein solches Verständnis von Arbeit und Leben den Menschen auf tierische Funktionen wie Fressen, Verdauen und Ausscheiden.
Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht die Wochenarbeitszeit, sondern drei andere Aspekte in den Vordergrund rücken.
Bleiben wir kurz bei Marx und seiner Mehrwerttheorie: Die Eigenschaft der menschlichen Arbeit besteht darin, mehr herstellen zu können, als zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Arbeitskraft erforderlich ist. Wie immer man dieses Mehrprodukt zwischen „Arbeiter“ und „Kapitalist“ aufteilt, ohne dieses Mehrprodukt hätten wir keine Gestaltungsfreiheit. Wir würden wie Tiere von der Hand in den Mund leben und könnten nichts schaffen, was nicht sofort einen Ertrag abwirft. Wenn wir also zusätzlich zu den gegebenen Lebensverhältnissen etwas Außerordentliches, etwas Neues und Großes bewerkstelligen wollen – etwa den grundsätzlichen Umbau einer Infrastruktur –, dann müssen wir eben mehr arbeiten. Wer das eine fordert und das andere ablehnt, der meint es nicht ernst. Natürlich können Kredite eine sinnvolle Überbrückung sein, aber wer Staatsschulden prinzipiell für eine tolle Sache hält, der sagt nur, dass er selbst zwar nicht mehr arbeiten möchte, aber künftige Generationen gefälligst umso mehr.
1889 wurde in Deutschland die gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. Das Renteneintrittsalter betrug zunächst 70 Jahre und wurde erst 1916 auf 65 gesenkt – bei einer Lebenserwartung von weniger als 50 Jahren, selbst wenn man die hohe Kindersterblichkeit herausrechnet. Heute hat sich das Renteneintrittsalter kaum verändert, aber die Lebenserwartung fast verdoppelt. Das heißt einerseits: Wir müssen länger arbeiten. Aber es ist vor allem eine gute Nachricht: Wir können länger arbeiten. Vor allem müssen wir davon wegkommen, bei „Silver work“ sofort an Altersarmut zu denken.
Salopp gesagt: Ein Drittel der Menschen im Rentenalter kann länger arbeiten und will das auch – ihnen sollte man weder im Beamten- noch im Sozialrecht Steine in den Weg legen. Ein zweites Drittel könnte, aber will nicht. Diese Menschen werden wohl müssen oder eben Abschläge hinnehmen. Und es gibt ein letztes Drittel von Menschen, die vielleicht sogar wollen, aber nicht mehr können, jedenfalls nicht im angestammten Beruf oder in der bisherigen Tätigkeit. Für diese Gruppe muss man Lösungen finden, die aber nicht nur in billiger „Lebensleistungs“-Rhetorik bestehen können. Ich wundere mich in Diskussionen immer darüber, wie viele Menschen 70-jährige Dachdecker kennen und deshalb sofort das Denken einstellen.
Neben dieser notwendigen Anpassung an eine erfreuliche demografische Entwicklung würde ich vor allem bei den Tätigkeiten ansetzen, die keine wertschöpfende Arbeit beinhalten. Wenn Zugtoiletten verdreckt sind, wenn Läden, Arztpraxen und Gaststätten wegen Personalmangel schließen, dann fehlt es doch offenbar an Arbeitskräften. Wo sind all die hin, die das früher gemacht haben? Seit einiger Zeit kann man sich auch fragen, warum die Arbeitslosigkeit trotz fehlendem Wirtschaftswachstum nicht stärker steigt. Eine aktuelle Studie der Bundesagentur für Arbeit liefert die Erklärung, die ohnehin jeder vermutete, der mit offenen Augen durch die Welt geht: Es wurden in den vergangenen drei Jahren 550.000 neue Stellen mit bürokratischen Aufgaben geschaffen. Das Bedrückende dabei: 325.000 davon in Unternehmen. Und noch bedrückender: Zwei Drittel davon wiederum in Kleinbetrieben unter 50 Mitarbeitern. Der Staat macht den Unternehmen Arbeit, und die Bürokraten auf beiden Seiten können sich wunderbar miteinander beschäftigen.
Bei Bürokratie geht es am wenigsten um umständliche Formulare und staubige Aktenordner. Es geht um eine wachsende Schicht, die nichts Wertschöpfendendes beiträgt, die den Wertschöpfenden auf der Tasche liegt und sie durch Überregulierung und Meldepflichten von der Arbeit abhält. Die FAZ kommentiert zu Recht:
Was hätte man mit dieser Arbeitskraft alles erledigen können. In die Bürokratie flossen doppelt so viele neue Stellen wie in die Informationstechnik, doppelt so viele Stellen wie in die Kindererziehung, viermal so viele Stellen wie in die Pflege. Fast jedes Problem des Landes würde mit einem sinnvollen Bürokratieabbau wirksam bekämpft.
Man muss hinzufügen: Ohne eine einzige Minute mehr Wochenarbeitszeit!
Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel "Links oder rechts oder was?" veröffentlicht. Seine Kolumne "Oben & Unten" erscheint jeden zweiten Mittwoch.
Newsletter: Anmeldung über Pareto