

Ulrike Demmer ist vor mir da. Das will etwas heißen, weil ich immer viel zu früh bin. Atmosphäre schnuppern, Puls senken. Wir sind in der Wohnstube von Potsdam. Ein Prunkbau, dieser Landtag. Im Hof flanieren Touristen. Demmer und ich werden gleich vor dem Hauptausschuss sprechen. Es geht um die Medienstaatsverträge. Die Reform der Reform der Reform. Eigentlich macht es wenig Sinn, hier als Sachverständiger aufzutreten – in einem von 16 Landtagen, die in diesem Verfahren allenfalls eine Statistenrolle haben. Trotzdem. Ich dachte mir: warum nicht? Dann steht wenigstens im Protokoll, wie ich die Dinge sehe, und außerdem bildet selbst eine Reise nach Brandenburg.
Erkenntnis Nummer eins: Die AfD hat kein Monopol auf Medienkritik, zumindest hier nicht. Jörg König, der für den Kronberger Kreis spricht, einen wirtschaftspolitischen Think Tank, und Tilo Bernhardt, ein Journalist, nominiert vom BSW, die beide vor mir dran sind, legen den Finger in die Wunde. Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit? Fehlanzeige. ARD und Co., daran lassen König und Bernhardt keinen Zweifel, schaffen es so längst nicht mehr, alle zu erreichen. Es geht um bürgerferne Gremien, um fehlende Effizienz (12.000 Euro pro Sendeminute, sagt König), um die Kritik an den Gaza-Berichten, formuliert zum Beispiel von Nadia Zabouri.
Erkenntnis Nummer zwei: Politiker sind selbst dann Politiker, wenn sie in den Chor der Kritiker einstimmen. Das heißt: Sie bleiben an der Oberfläche und bei sich selbst. Ein BSW-Mann sagt allen Ernstes, dass er ZDF neo ohnehin nur in der Mediathek schaue. Es sei also kein Problem, wenn solche Sachen künftig nicht mehr linear zu haben sind. Und ein CDU-Kollege benennt zwar mit dem Streaming einen Trend, der das lineare Fernsehen fortspülen und damit Quotenbringer (Fußball, Filme, Shows) genauso obsolet machen könnte wie jeden Blick auf den Audience Flow, verbeißt sich dann aber an Jan Böhmermann. Der Unterschied zu Karl-Eduard von Schnitzler? Keiner. Nur die Musik sei heute besser.
Erkenntnis Nummer drei: Ulrike Demmer kann sich auf ihre Verbündeten verlassen. Sie muss sich folglich nicht anstrengen. Anders ist der gelangweilte Auftritt nicht zu erklären. Die Freien, sagt sie allen Ernstes, können beim RBB „unabhängig“ berichten. Heilige Einfalt. Neben ihr sitzt Susanne Pfab, ARD-Generalsekretärin. Man weiß ja nie. Wir haben zwar keine Argumente, aber zwei Frauen. Pfab verteidigt das KEF-Verfahren mit den Begriffen „staatsfern“ und „Planungssicherheit“. 16 Leute, von den Ministerpräsidenten berufen und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Staatsfern. Was soll man dazu sagen? Dass in Brandenburg acht Prozent der Beitragskonten in Mahnverfahren sind oder in der Vollstreckung, spielt diese Spitzenfrau herunter. Ziemlich genau die Zahl der überschuldeten Haushalte, sagt sie. Übersetzt: Wir wollen nicht sehen, was draußen läuft, auch in Sachen Gremien nicht. Ein SPD-Mann sagt, er sei doch nicht im Rundfunkrat, weil er ein Parteibuch habe, sondern als Abgesandter des Landtags. So kann man sich die Dinge schönreden.
Neben Pfab und Demmer sitzt Eva Flecken, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Eine Frau mit Doktortitel, die einfach am Thema vorbeiredet und über Pornos und Jugendschutz spricht. Die letzte Waffe, wenn man so will. Wenn gar nichts mehr geht, drücken wir auf die Emotionstaste und lassen so vergessen, dass diese Behörde aus dem Beitragstopf bezahlt wird, damit sie kommerzielle Anbieter und das Netz kontrollieren kann. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist – diese Aufseherin, die nicht verstehen will, was die Stunde geschlagen hat, oder Kathleen Eggerling, Gewerkschaftssekretärin, die vorher auf Fleckens Stuhl saß und in feinstem Gender-Deutsch gegen alle Einschränkungen und Streichungen war, um den Kampf gegen „Fake News“ und „Desinformation“ nicht zu verlieren. Nun denn. Eine Gewerkschaft, die gar nicht auf die Idee kommt, die Freien zum Thema zu machen, ist sicher genau das, was gebraucht wird.
Erkenntnis Nummer vier: Meine Idee, die Finanzierung vom Kopf auf die Füße zu stellen, wird diskutiert. Immerhin. Weg vom Selbstbedienungsladen KEF-Verfahren, hin zu einem klaren Auftrag ohne Unterhaltungs-Schnickschnack (Öffentlichkeit herstellen: alle Themen, alle Perspektiven) mit einem fixen Budget, deutlich kleiner als bisher. Das hält auch Christoph Degenhart nicht für völlig utopisch, ein Urgestein in der Medienjuristenszene. Mehr dazu im Büchlein Staatsfunk. Als Appetizer folgen meine fünf Potsdam-Minuten (ohne Diskussion).
Frau Minister, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich werde zunächst zwei Sätze zum Kontext sagen, persönlich und gesellschaftlich, dann drei inhaltliche Punkte aufgreifen und die Dinge zum Schluss zusammenführen. Zuerst zu mir. Ich bin in der DDR aufgewachsen, kenne den Rundfunk von innen und von außen, als Journalist und als Forscher, und habe 1989 erlebt, wie die Unzufriedenheit mit der öffentlichen Kommunikation ein politisches System zum Einsturz gebracht hat.
Das ist der Link zur Gegenwart, bei mir Teil zwei in Sachen Kontext. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in einer beispiellosen Legitimationskrise. Jeder hier im Haus kennt die Zahl der Beitragsverweigerer (in Brandenburg über acht Prozent) und jeder weiß, was sehr viel mehr Menschen auf die Palme bringt – der Zugriff von Staat, Behörden und Regierungsparteien auf ein Programm, das sich deshalb bei zentralen Themen wie Klima, Corona oder Krieg auf „offizielle“ Positionen beschränkt, Widerspruch ausblendet oder abwertet, so keine öffentliche Debatte erlaubt, die diesen Namen verdient, und folglich den „Auftrag“ verfehlt, der im Medienstaatsvertrag steht und der allein die Finanzierung aus Rundfunkbeiträgen rechtfertigt.
Die drei Gesetzentwürfe, um die es heute geht, schreiben das System fort, das zu dieser Legitimationskrise geführt hat, und entfernen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Medienrat und Widerspruchsmodell noch weiter vom Souverän und damit auch von ihnen, sehr geehrte Abgeordnete. Ich greife hier nur die drei Punkte Finanzierung, Aufsicht und Arbeitsbedingungen heraus. Das KEF-Verfahren, mein erster Punkt, hat einen Selbstbedienungsladen produziert. Die KEF kann nicht sinnvoll prüfen, was ihr die Anstalten vorlegen. Es gibt keinen Maßstab, weil kommerzielle Anstalten einen anderen Auftrag haben, es gibt keine öffentliche Kontrolle, weil in der KEF Schweigepflicht herrscht, und es gibt auch keinen parlamentarischen Hebel. Dass die Landtage hier Statisten sind, hat das Beispiel Sachsen-Anhalt gelehrt.
Zum zweiten Punkt, zur Aufsicht, gibt es aktuelle Zahlen. 42 Prozent der Rundfunkräte lassen sich Parteien zuordnen und 53 Prozent der Verwaltungsräte. Ich kenne die mentale Hürde, vor der Abgeordnete stehen, die das ändern wollen. Es geht um Verzicht – um Verzicht auf die Möglichkeit, an den wichtigsten Schrauben zu drehen, am Spitzenpersonal und an den Budgets. Mit dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion liegt ein Modell für einen Befreiungsschlag vor. Direktwahl, Verkleinerung, klare Regeln. Kein Medienrat weit weg von Beitragszahlern, Wählern, Abgeordneten. Damit ließe sich Vertrauen zurückgewinnen.
Das gilt auch bei meinem dritten Punkt, Arbeitsbedingungen. Im Moment produziert die Hierarchiepyramide auf jeder Stufe Abhängigkeiten, die in den Redaktionen zu Misstrauen, Unmut und Angst führen und alles verhindern, was für journalistische Qualität sorgen könnte – eindrucksvoll dokumentiert im Klimabericht des NDR. Auch hier braucht es einen Befreiungsschlag. Obergrenzen ganz oben, feste Arbeitsverträge ganz unten und überall Tarife wie im öffentlichen Dienst.
Sehr geehrte Abgeordnete, ich weiß, dass es leichter ist, ja zu sagen. Aber einer muss den Anfang machen. Wenn nicht Brandenburg, dann über kurz oder lang einer der anderen ostdeutschen Landtage. Wenn Sie an der Idee eines öffentlich-rechtlichen Medienangebots festhalten wollen, dann müssen Sie erstens die Finanzierung vom Kopf auf die Füße stellen und den Anstalten dafür neben einem Auftrag ein festes Budget zuteilen, deutlich kleiner als bisher. Sie sollten zweitens Publikumsräte etablieren, direkt gewählt oder ausgelost. Und Sie sollten den Redaktionen drittens die Freiheit geben, die mit Kündigungsschutz verbunden ist sowie mit Statuten, die Transparenz und Vielfalt sichern. Vielen Dank.
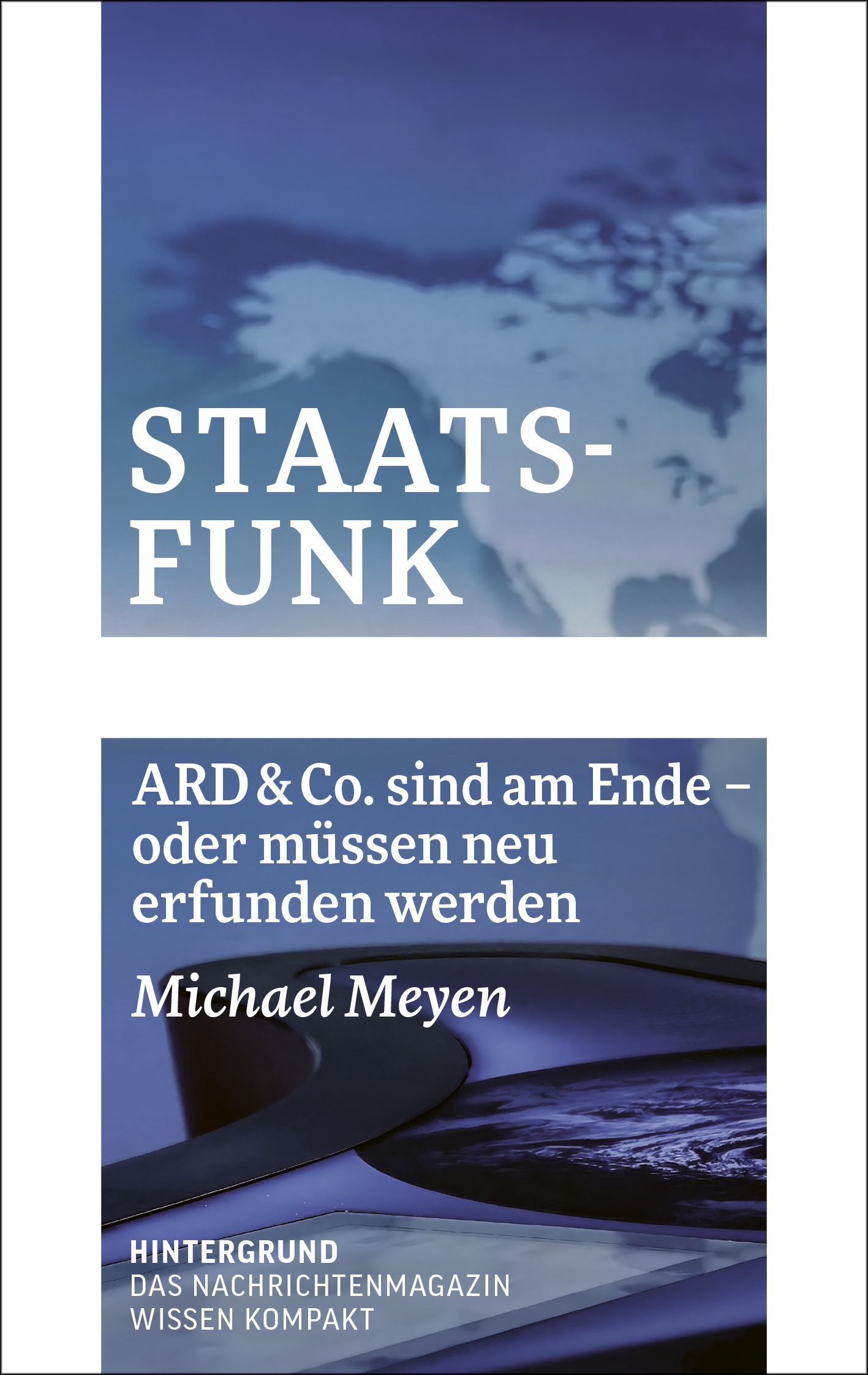
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus