

Ich weiß: Das Thema hatten wir hier schon. Dinge, die auf merkwürdige Weise ineinanderfließen. Ich will gar nicht mit den kleinen Helferlein anfangen, von denen eine Freundin in dieser Woche begeistert berichtet hat – Wesen aus der geistigen Welt, die uns begleiten und, so hat sie das erzählt, dafür sorgen, dass sich alles fügt. Mag sein. Vielleicht lenkt auch etwas anderes die Aufmerksamkeit, Energie zum Beispiel. Egal. Ich habe jedenfalls ein Buch in die Hand genommen, das schon ewig auf dem Tisch gewartet hat, und dort eine Erklärung für das gefunden, was gerade passiert. Brosius-Gersdorf im Großen und ein Satz im Kleinen, über den ich beim Schreiben gestolpert war.
Damit Sie mir folgen können: Ich habe Montag ein Manuskript an den Verlag geschickt, Arbeitstitel: Staatsfunk. Dieser Titel ist Diagnose, Prognose und Vorschlag. In Kurzform: Der Tag ist nicht mehr fern, an dem der Schleier verschwindet – das Märchen von einem Volk, das einen Rundfunk besitzt, seine Besten schickt, um die Programme zu kontrollieren, und dafür voller Freude jeden Monat Geld überweist. Ich bin dafür zu den Wurzeln gegangen, ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts, und habe mir dann die Hebel angeschaut, über die Staat, Regierungen und Apparate seit 1945 bestimmen, was gesendet wird, obwohl das Märchen ja sagt, dass sie genau das nicht tun dürfen.
Gestolpert bin ich beim Thema Geld, genauer: beim Streit um die jüngste Empfehlung der KEF, einer Kommission, die von den Ministerpräsidenten besetzt wird und so tun soll, als ob es eine unabhängige Prüfung der Summen gibt, die die Anstalten gern hätten. Ich wusste, dass die Entscheidung auf Eis liegt, weil nicht alle Landesfürsten sicher sind, was das Stimmvolk mit ihnen machen wird, wenn der Rundfunkbeitrag tatsächlich erhöht werden sollte. Gestaunt habe ich, wie die Anstalten darauf reagiert haben. ARD-Chef Kai Gniffke beschwor die Mythen „staatsferne Finanzierung“ und „journalistische Unabhängigkeit“, sprach von einer „Verletzung des Verfahrens“ und sagte: „Gesetze sind einzuhalten. Recht und Gesetzestreue kennen nun mal keine Kompromisse“.
Nochmal langsam: Das „Verfahren“ ist heilig und das Gesetz auch – völlig unabhängig davon, was der Beitragszahler möchte oder ein von ihm gewähltes Parlament. Dieses „Verfahren“ ist immer wieder geändert worden, um den Eindruck zu verwischen, es handele sich um einen Selbstbedienungsladen, in dem wir einfach bezahlen, was ARD und Co. gerade bestellt haben. Plötzlich aber wird alles in Stein gemeißelt. Keine Kompromisse. Verfahren und Gesetz sagen, was wir zu tun haben. Mehr Geld für den Rundfunk, obwohl der Unmut wächst und obwohl gut acht Prozent der Beitragskonten in Mahnverfahren sind oder in der Vollstreckung.
Kai Gniffke, das habe ich jetzt bei Philip Manow gelernt, schwimmt damit auf einer Welle, die auch die reiten, die tagein, tagaus „unsere Demokratie“ beschwören und überall „Feinde“ sehen, die die Demokratie angeblich bekämpfen. Manows Buch „Unter Beobachtung“ hält nur zum Teil, was der Untertitel verspricht. „Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde“. Die Freunde habe ich vergeblich gesucht, aber verstanden, dass die „liberale Demokratie“ erst um 1990 das Licht der Welt erblickte und sich nach und nach ihre Feinde genauso erschaffen hat wie eine Erzählung, die uns glauben lässt, dass „Demokratie“ schon immer genau das war, was wir heute haben, oder zumindest auf diesen Punkt hinausgelaufen ist.
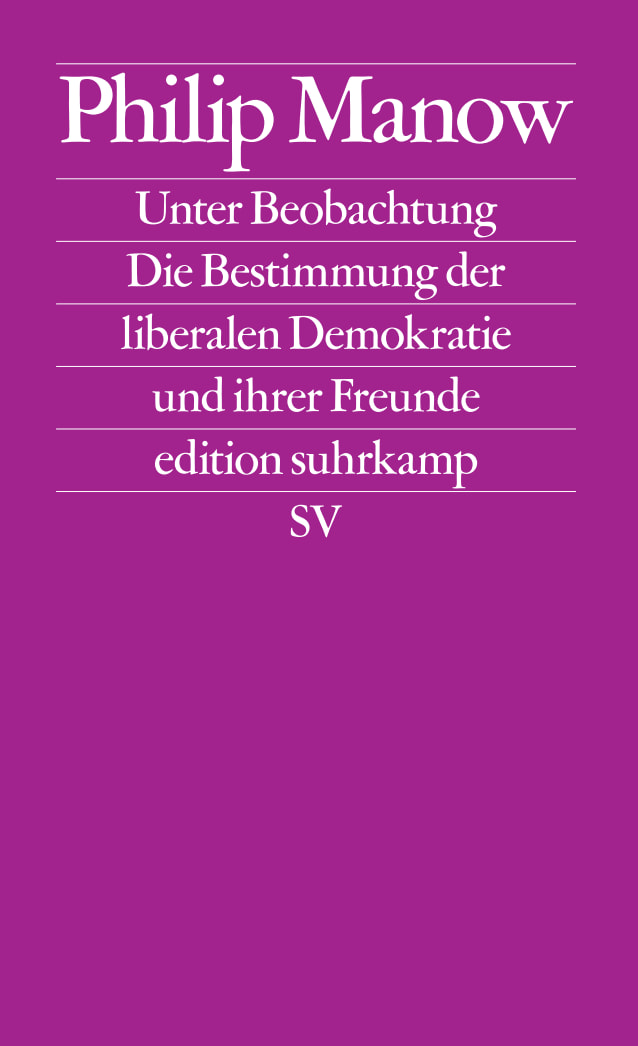
Philip Manow, Jahrgang 1963, ist Politikwissenschaftler und dazu noch Professor. Da ich selbst seit einer halben Ewigkeit im Elfenbeinturm sitze, verputze ich Texte von Kollegen wie Vanilleeis und weiß nicht mehr wirklich, was man erklären muss, damit jeder folgen und vor allem genießen kann. Vielleicht nur das: Manow sagt erstens, dass wir uns nie darauf einigen werden, „was wir unter Demokratie verstehen“ (S. 67). Jeder möchte, Punkt zwei, eine Idee durchsetzen, die ihm zu „politischer Macht“ verhilft (S. 68). Wer sich in der Mehrheit wähnt, setzt auf Abstimmungen, und wer in der Minderheit ist, warnt vor einer Tyrannei der Mehrheit und sucht nach – genau. Verfahren. Recht. Gesetzestreue. Kai Gniffke.
Spannend wird es bei Punkt drei. Philip Manow zeigt in seinem Büchlein zum einen, dass das, was wir unter Demokratie verstehen, immer von dem Setting abhängt, in dem wir uns gerade bewegen. Und zum anderen kann man bei ihm lesen, wie sich dieses Setting mit dem Umbruch in Osteuropa verändert hat. Stichworte sind hier
Wenn das zu viel Akademiker-Kauderwelsch gewesen sein sollte: Wer „Demokratie“ mit Wahlen gleichsetzt, mit dem Mehrheitsprinzip und mit Volkssouveränität, der lebt in der Vergangenheit und rückt fast automatisch in den Rang eines Demokratiefeindes, weil die aktuelle Spielart (= „unsere Demokratie“ oder eben „liberale Demokratie“) Gewaltenteilung ins Zentrum stellt und subjektive Rechte, die im Gerichtssaal locker alles übertrumpfen, was Volksvertretungen auch immer beschlossen haben mögen. Mehr noch: Die Verfassungsgerichte machen selbst Politik und binden das Volk auf ewig an irgendwelche Ziele, die sich angeblich zwingend aus mehr als wackligen Modellen ergeben sollen.
Über die EU als solche haben wir da noch gar nicht gesprochen und auch nicht über Frauke Brosius-Gersdorf. Wenn Gerichte (und erst recht: Verfassungsgerichte) mächtiger werden und sich heute auch mit Blick auf die Regierung im eigenen Land kaum noch beschränken müssen, weil sie im Europäischen Gerichtshof einen Verbündeten haben, der selbst keinen ernstzunehmenden Gegenspieler kennt, dann verwundert es nicht, dass Roben zum politischen Kampfplatz werden. Als Frage formuliert: Welche Partei mag noch um Wählerstimmen ringen, wenn ein „überschaubares Richtergremium, nicht gewählt, durch niemanden zu kontrollieren und zu sanktionieren“, am Ende selbst „klare politische Mehrheiten“ aushebeln kann (S. 113)?
Für den Gniffke-Satz in meinem Buch über den Staatsfunk heißt das: Es ist tatsächlich egal, was das Publikum will, einerseits. Andererseits weiß ich jetzt, dass Alexander Teske richtig liegt, wenn er sagt, dass Klagen gegen den Rundfunkbeitrag eher Erfolg versprechen als Beitragsflucht. Vielleicht kippen Verfahren und Gesetze ja schon im Herbst vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. An meinen kleinen Helferlein soll das jedenfalls nicht scheitern.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus