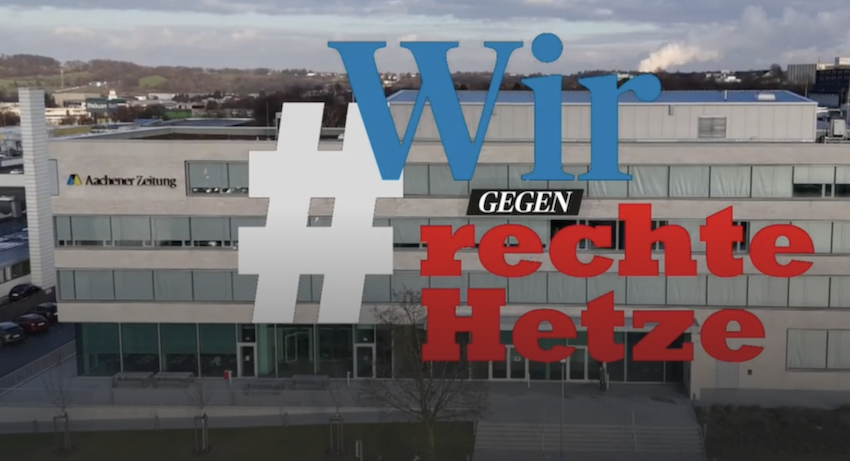
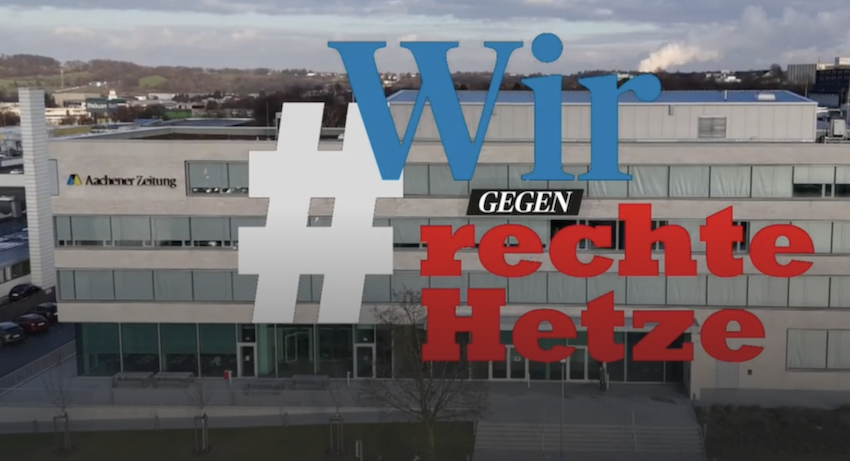
Drei kleine Erlebnisse an einem Tag:
Solche Erlebnisse selbstbewusster Unfähigkeit häufen sich in meiner Wahrnehmung. Und sie beunruhigen mich, weil sie keine Fehler sind, wie sie jeder macht, der arbeitet. Irgendwie habe ich das Gefühl struktureller Unfähigkeit – gepaart mit mangelndem Problembewusstsein. Was ist hier passiert? Waren wir Deutschen nicht mal bekannt dafür, Olympische Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften organisieren zu können – oder 1992 den Umzug des Flughafens München von Riem nach Erding über Nacht ohne Betriebsunterbrechung?
Noch mehr irritiert mich, dass sich ähnliches auch im „geistigen“ Bereich findet. Bei Leuten, die sich für Intellektuelle halten oder sich als unsere geistigen Zuchtmeister verstehen. Mir geht es dabei nicht darum, dass jemand eine andere Position als ich vertritt, aber wie kann ich über unterschiedliche Positionen einen Diskurs auf Augenhöhe führen, wenn es auf der Gegenseite offensichtlich an Höhe fehlt?
Dass Sprache das Denken präge, ist eines der Argumente der Befürworter der Gendersprache. Was muss ich über das Denken der Befürworter denken, wenn ich mit Sätzen konfrontiert werde wie „Ein:e Rechtsanwalt aus der Branche XY hat ihr Profil angesehen“ oder „Wir suchen noch PädagogenInnen“?
Nach der Störung des Sommerinterviews mit Alice Weidel wurde einerseits die Gefahr einer rechten Mehrheit an die Wand gemalt – manche Rechnungen, die neben AfD auch CDU/CSU, FDP oder gar BSW einbeziehen, kommen in der Tat auf 60 Prozent. Gleichzeitig feiert ein Sascha Pallenberg („Person of the year“, Time Magazine):
Es gibt offenbar eine laute Mehrheit, die Vertretern rechtsextremer Inhalte friedlich zu verstehen gibt, dass man diese in unserer Gesellschaft nicht toleriert. (LinkedIn, 27.7.2025)
Mich erinnern solche Widersprüche an eine Überschrift im Handelsblatt vor einigen Jahren (28. Dezember 2020): „Trotz sinkender sozialer Akzeptanz: SUV-Anteil wird weiter steigen.“ Ich persönlich bin kein besonderer Freund von SUVs, aber wenn die Absatzzahlen steigen, dann steigt doch auch die soziale Akzeptanz, oder bin ich da zu streng?
Bei einer Google-Suche traf ich auf folgende Initiative:
Die Aachener Zeitung ist für einen pluralistischen Diskurs über die Zukunft des Landes, Europa und der Welt. Nur so entsteht echte Demokratie. Wir wenden uns dabei gegen diejenigen, die mit ihrem rechtsextremen Gedankengut eben diese Pluralität gefährden. Wir freuen uns über alle wehrhaften Demokraten, die uns dabei unterstützen. (8. Februar 2024)
Jeder, der Texte schreibt, macht Fehler – das gilt auch für mich. Aber genau wie bei den Beispielen zu Beginn geht es nicht um Fehler, sondern um strukturelle Unfähigkeit. All den sprachsensiblen Aktivisten, die sonst ständig mahnen und anprangern, den Redakteuren im Dienste der Weltrettung, den eifrigen und beseelten Likern und Kommentatoren bei LinkedIn scheinen solche logischen Widersprüche nicht mehr aufzufallen. Das muss man erst mal schaffen!
Häufig wird der Begriff der „urbanen Eliten“ gebraucht – mit einem kritischen Unterton und als Synonym für lebensferne wohlhabende Schichten. An der urbanen Lokalisierung mag was dran sein. Aber angesichts der beschriebenen Befunde denke ich immer häufiger: „Wenn es wenigstens eine Elite wäre!“ Eine Elite im Sinne irgendeiner Exzellenz. Oder wie der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann in einem anderen Zusammenhang sagte: „Dafür, dass es Intellektuelle unterschrieben haben, hätten sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen können.“ Von „Steuer:innenzahler“ bis „Mitglieder:innen“ wird Gendersprache immer mehr zum Erkennungszeichen bildungsferner Schichten. Auf diesen Weg lernen wir, dass ein akademischer Abschluss und eine renovierte Altbauwohnung offenbar kein Bollwerk gegen Bildungsferne sind.
Jede Gesellschaft braucht das Streben nach Exzellenz. Welchen Sinn hätte Arbeit, wenn sie nicht nach einem möglichst guten Ergebnis strebte? Das gilt für Verwaltungsprozesse und Garagentorstreichen. Und es gilt für den gesellschaftlichen Diskurs: Mit einem dumpfbackigen „Gegen rechts!“ werden wir nichts und niemanden erreichen. Da müssen wir uns schon ein bisschen mehr anstrengen. Beim Denken und beim Arbeiten.
Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel "Links oder rechts oder was?" veröffentlicht. Seine Kolumne "Oben & Unten" erscheint jeden zweiten Mittwoch.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus