

„Wenn man einmal aus nächster Nähe ein Gefecht erlebt hat, erledigen sich zwei Drittel der schönen Literatur von ganz allein.“ (S. 158)
Als die Rezensentin diesen Roman kurz nach seinem Erscheinen zum ersten Mal las, war es noch unvorstellbar, daß zu ihren Lebzeiten außerhalb des ehemaligen Jugoslawien in Europa ein Krieg stattfinden könnte. Der Balkan: Naja, da leben temperamentvolle Menschen, denen das Messer schon immer etwas locker im Gurt hing, wurde über Generationen kolportiert. Aber Zentraleuropa, gar Nordeuropa? Ausgeschlossen. Nun ertönen sie wieder, die Kriegstrommeln. Kriegsfähig sollen wir werden, aufgerüstet wird, weil angeblich Rußland Europa überfallen will oder gar schon dabei ist. Das scheint ausgemachte Sache zu sein. Was für die Regierungen selbstverständlich zu sein scheint, darüber können ihre Bevölkerungen nur den Kopf schütteln. Doch Kriegsgeschrei hat eine Eigendynamik. Geht man einen Schritt zu weit, ist am Gang der Dinge nichts mehr zu ändern und das lange Zeit Vermeidliche wird Wirklichkeit.
Über die verschiedenen Kriege der neunziger Jahre auf jugoslawischem Boden ist viel geschrieben worden. Zu den bedeutendsten fiktionalen Darstellungen zählen die von Peter Handke und Mathias Énards Roman „Zone“ von 2008. Wie schon Handke fokussiert sich auch Norbert Gstrein auf die Rolle der Berichtenden, der Chronisten und Journalisten in diesem verwirrenden Kriegsgeschehen.
Das „Handwerk des Tötens ist ein jahrtausendaltes Geschäft“, und Kriegsberichterstattung gibt es schon seit Menschengedenken. Sie veränderte sich mit der Technik und den Gesellschaftsstrukturen. Gstrein beobachtet Kriegsbeobachter der ausgehenden Moderne, in Sonderheit zwei deutsche Journalisten. Personnage und Versuchsanordnung sind speziell und gewagt: Die Handlung spielt im Wesentlichen 1999 in Hamburg, es findet sich nur ein auswärtiger Handlungsstrang: ein Aufenthalt im Kosovo. Und diese Handlung besteht ausschließlich aus der Wiedergabe von Gesprächen zwischen vier Personen. Ein namenloser Ich-Erzähler gibt selbst Gehörtes und ihm Hintertragenes wieder. Der Journalist Allmayer ist im Kosovo erschossen worden, und sein Freund Paul, der eigentlich nicht viel mehr ist als ein Bekannter und der ebenfalls sein Einkommen aus Kriegsberichterstattung bezieht, recherchiert zu Allmayers Leben und Sterben, um einen Roman darüber zu schreiben. Unser Erzähler ist ebenfalls Journalist, allerdings einer ohne besondere Ambitionen. Für Paul, dessen Ex-Frau Helena und die Witwe Allmayers sowie dessen Geliebte ist der Erzähler ein Ansprechpartner – im Grunde ein Mittler wie in Goethes „Wahlverwandtschaften“. Er gibt im Roman wieder, was ihm anvertraut wird, wie er reagiert und wie er sich in den Gesprächssituationen fühlt.
Der Stoff des Romans ist also das Kriegsgeschehen im auseinanderfallenden Staatsgebilde Jugoslawien der neunziger Jahre. Thematisch beschäftigt sich das Buch zum einen mit der Praxis westlicher Journalisten und Medienmachern, und zwar pars pro toto, zum anderen mit der psychischen und moralischen Verfassung Europas in dessen Verfallszeit.
So betrachtet Paul das Unglück seines Kollegen Allmayer im Hinblick auf seine Verwertbarkeit. Jedoch:
Ein Toter macht noch keinen Roman.
Es gilt zu fiktionalisieren. Paul ist bei allem Grauen, das ihn angesichts der Kriegswirklichkeit erfaßt, fasziniert von dem Gesehenen. Der unübersehbare Kitzel des Unvorstellbaren, die Lust, die er beim Ausmalen von Details empfand, steht im Vordergrund und läßt ihn die Kriegsberichterstattung nicht einfach aufgeben. Paul genügt, wenn man dem Berichtenden glaubt, die „Ungeheuerlichkeit dessen, was er gelesen hatte, nicht, er mußte etwas daraus machen“. Und: „Er hätte es am liebsten ausgeschmückt.“ So schwärmt Paul von ungeahnten Möglichkeiten, die sich für seinen Plot aufgrund einer unerwarteten Begegnung ergeben. Und er vermischt die Ebenen: Das reale Unglück im Krieg betrachtet er vor der Folie des Filmtods in Karl-May-Verfilmungen. Und der erzählende Vermittler versteht langsam, daß Paul auch an ihm seine Romanszenen ausprobiert.
Je mehr Details er ausbreitete, umso mehr schienen sie sich gegenseitig auszulöschen, schienen noch die größten Abscheulichkeiten im einmal vorgegebenen Rahmen am Ende normal zu sein.
Die Maßstäbe verschieben sich. Das Unwirkliche wird wirklich, und man fragt sich als Zuhörer, „welche Phantasien bis dahin unbescholtene Leute, … entwickelt haben sollen, was für ein Vergnügen, einen Gefangenen zu zwingen einem anderen die Hoden abzubeißen und sie vor ihm zu essen“.
Gegenüber seiner Exfrau, der Kroatin Helena, versteigt Paul sich in Diffamierungen:
Ihr seid ein Kriegervolk.
Er nimmt ihre Wangenknochen zwischen Daumen und Zeigefinger und sagt: slawisch, slawisch. Dabei wendet er sich zum Erzähler hin, als erwarte er eine Form von Applaus. Er benutzt die Frau als Verbindungsoffizier zu seiner Romanwirklichkeit. Paul hat ständig verstiegene Ideen. Doch wie er hier mit seiner Muse Helena, die er auch als seinen „Todesengel“ bezeichnet, umgeht, kann nur als Grenzüberschreitung bezeichnet werden: Er wolle mit ihr gemeinsam zu der Stelle fahren, an der Allmayer zu Tode kam.
Für mich wäre schon interessant, wenn ihr dort etwas zustoßen würde.
Beide könnten in einen Hinterhalt geraten. Ergiebig für den Roman wäre, wenn sie in die Hände eines Bandenführers fiele. Sie könnte auf eine Mine treten oder sogar schwanger sein. Ob er sie überleben ließe oder nicht, will er erst später entscheiden. Paul macht keinen Unterschied mehr zwischen der realen und der fiktiven Helena. Alberto Moravia hat dem Motiv der Instrumentalisierung des Liebespartners 1954 einen sehr beeindruckenden Roman gewidmet: „Die Verachtung“ spielt in der Filmbranche. Im Kulturbusiness scheint es keine Loyalitäten zu geben. Wahrscheinlich aber ist in Jobs, die der Marktlogik unterliegen, Loyalität ein rares Gut. Auch Helenas Darstellung des mit Allmayer Erlebten stört den Mittler:
zu viele Paradoxa, mit denen sie beabsichtigte, nichts an sich heranzulassen, zu viele Anekdoten, die gar nicht so grau sein konnten, als daß sie nicht doch etwas Funkelndes gehabt hätten.
Und auch an mit Fakes arbeitenden Journalisten läßt der Erzähler respektive Romanautor keinen guten Faden, wenn er von Diskussionen in den Redaktionen zu der ewigen Frage schreibt, ob auch die größten Grausamkeiten gezeigt werden sollten. Immer wieder aufs Neue kommt man zu dem Schluß, Journalisten hätten die Pflicht dazu.
Es war ihr Sportreportergehabe, das er nicht mochte, die Art, wie sie um Zeilen und Minuten feilschten, wie sie sich überlegten, welche Aspekte man dem Krieg noch abgewinnen könnte, als das Spektrum längst ausgereizt war …, bis sie sogar so weit gegangen seien, als eine Art Kontrastprogramm die an den Rändern noch existierenden Idyllen auszugraben, auch wenn dabei nur der übliche folkloristische Schwachsinn herauskam.
Im Zweifelfall läßt sich auch ein schöner Leichenhaufen arrangieren, wenn die Wirklichkeit nicht drastisch genug ist. Der Erzähler formuliert sein Unbehagen über den Ton des Berichteten, seine „Abwehr gegen einen Blick, der sich erst auf etwas richtete, wenn es entweder zu verschwinden drohte oder gerade verschwunden oder am besten bereits verschwunden war.“
Allmayers Motivation, am Krieg als Journalist teilzunehmen, unterschied sich ein wenig von der Pauls. Er sei hungrig nach Leben gewesen. Sein Job war eine Abwehr gegen eine Art Normalität, mit der er nicht zurechtkam.
Der Frieden muß ihn noch einsamer gemacht haben, als er davor wahrscheinlich schon gewesen ist.
Verglichen mit dem Krieg war alles, was er bis dahin erlebt hatte, eine Nichtigkeit. Allmayer habe überhaupt erst mit dem Unsinn angefangen, weil er sich ohne die Aufregung tot fühlte, behauptet Helena. Analog zu den ostdeutschen Montagsdemonstranten gab es in Jugoslawien Wochenendkämpfer, erfährt der Leser, die von Montag bis Freitag einer geregelten Arbeit nachgingen und sich danach ins Plündern und Morden gestürzt haben, als wären sie nichts als normale Freizeitbeschäftigung.
Keine Regierung der Welt kann einen Krieg führen, wenn ihre Bevölkerung entschieden dagegen votiert und sich engagiert. Sie kriegstüchtig zu machen, erfordert Propaganda, Manipulation und ein überzeugendes Feindbild. Nach den Jahrzehnten des westlichen Wohlstandes in relativer Sicherheit könnte eine Art psychische Verwahrlosung die Ursache für moderne Kriegsausbrüche im Okzident sein. Ein Verrutschen der Maßstäbe scheint Lust auf und an Gewalt zu gebären. Das domestizierte Männchen muß kompensieren. Brutalität war schon immer ein Mittel der Wahl und ist offenbar durch keinen Zivilisierungsschub aufzuheben. Paul soll das letzte Wort haben, denn es drückt ein sozialpsychisches Phänomen aus, das leider wieder aktuell ist:
Ich habe die längste Zeit gar nicht richtig begriffen, daß der Krieg begonnen hatte … Gerade weil alles so nah war, ist es mir ganz und gar unwahrscheinlich vorgekommen. … Es mag noch so naiv klingen, aber ich habe am Anfang geglaubt, ein Wort von wem auch immer würde genügen, und der Spuk wäre augenblicklich vorbei.
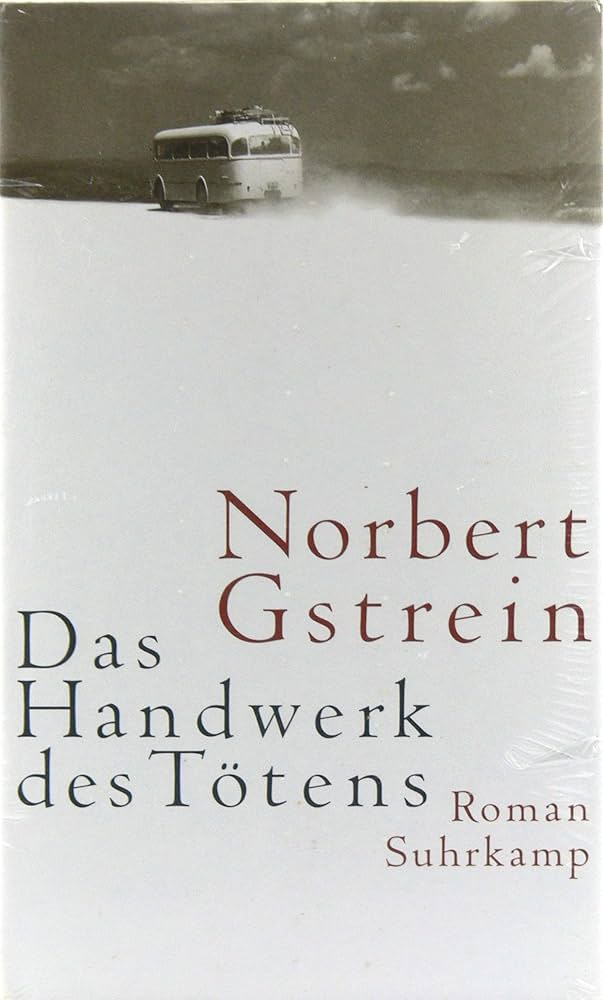
Norbert Gstrein: Das Handwerk des Tötens. Berlin: Suhrkamp 2003, 380 Seiten, 24,90 Euro.
Beate Broßmann, Jahrgang 1961, Leipzigerin, passionierte Sozialphilosophin, wollte einmal den real existierenden Sozialismus ändern und analysiert heute das, was ist – unter anderem in der Zeitschrift TUMULT. Wenn Zeit ist, steht sie am Buch-Tresen.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus