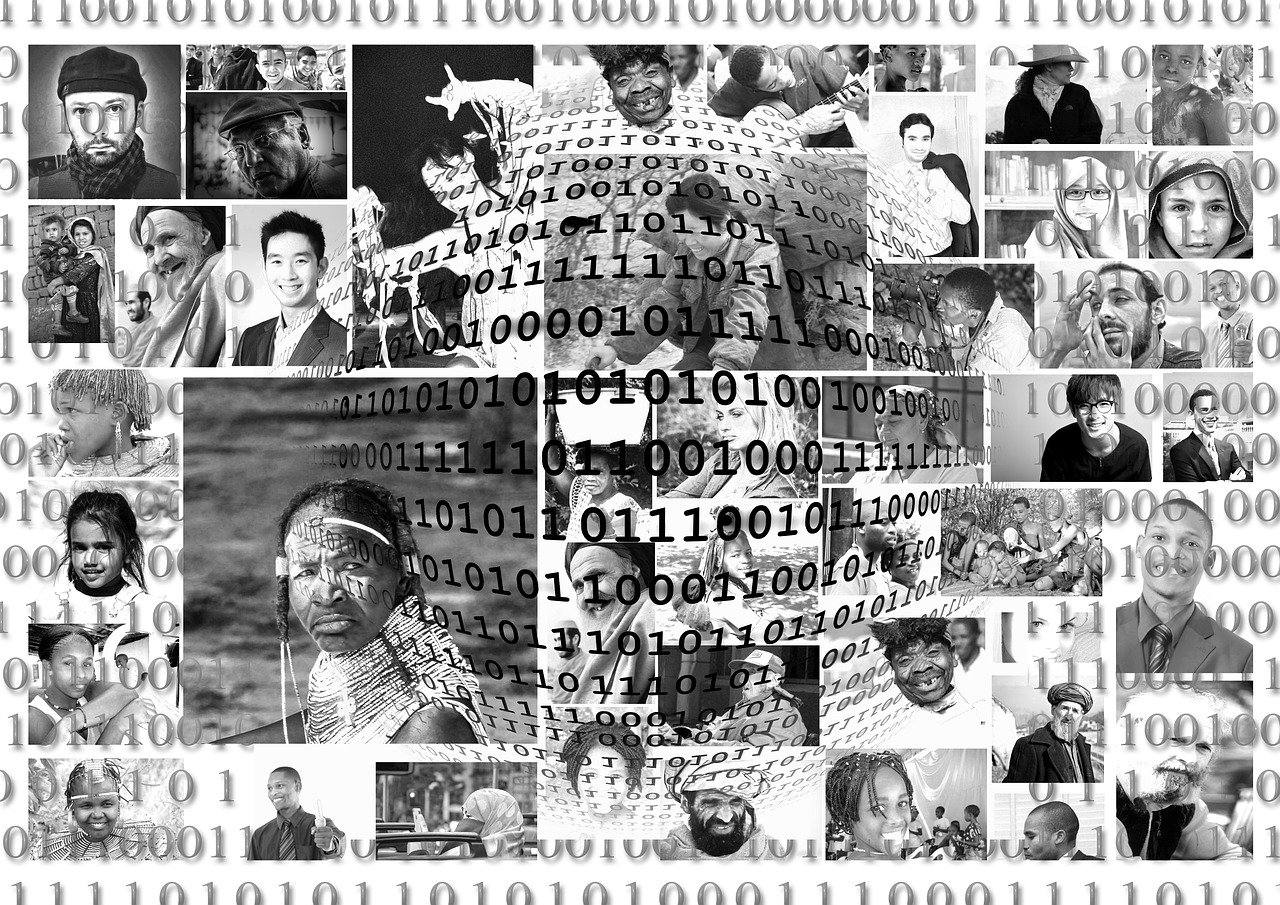
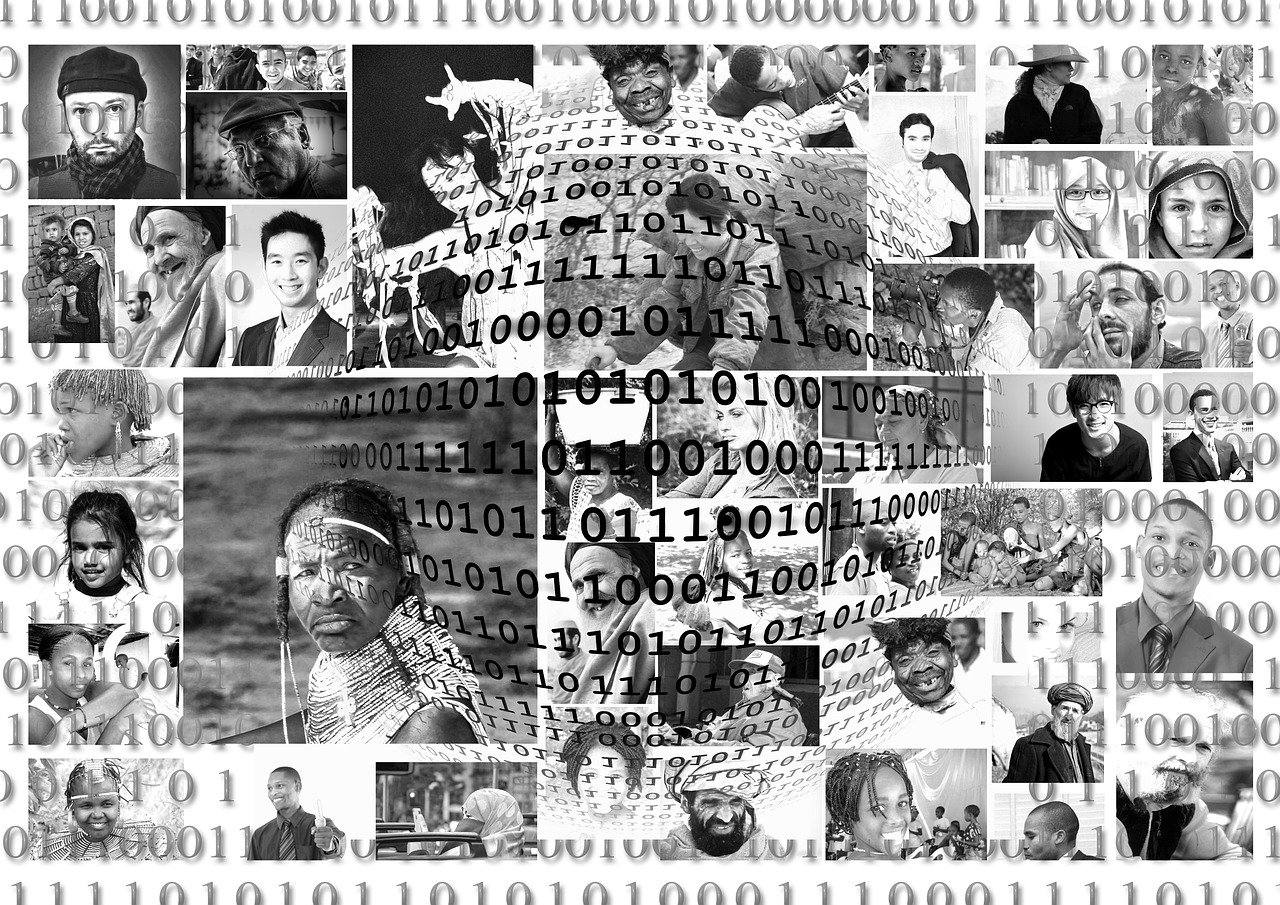
Vor einigen Jahren sollte ich in einem Hochschulseminar eine Diskussion über Gendersprache moderieren. Die Gendersprache war dabei nur Spielmaterial, eigentlich ging es um das Einüben von Diskurs. Und ich schwöre, dass die Studenten bis zum Ende meine Meinung nicht erkannten. Die eine Hälfte sollte pro und die andere Hälfte contra Gendersprache argumentieren. Es herrschte jedoch ein solcher Meinungsdruck, dass sich keine Freiwilligen für die Contra-Position fanden. Schon bei der Begriffsklärung sprachen sich alle für die härtesten und absurdesten Formen der Gendersprache aus, und das obendrein per Zwangserziehung ab Geburt. Wie im Laufe der Diskussion deutlich wurde, war es tatsächlich nur eine einzige Person, die diesen Meinungsdruck ausübte. Nach der Stunde bekam ich von Teilnehmern unaufgefordert Videos zugeschickt, die sich über Gendersprache lustig machten.
In seinem Buch „Das Ende des Individuums“ berichtete der französische Philosoph Gaspard Koenig von einer amerikanischen Tagung über mangelndes Vertrauen in öffentliche Institutionen:
Eine Teilnehmerin fragte, ob nicht das ganze Problem auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass die USA von weißen Männern gegründet worden waren. „Vollkommen“ war die begeisterte Antwort des Referenten. Der Rest des Podiums, bestehend aus Akademikern und Forschern, nickte eifrig, um nicht für immer als Verräter, als white supremacists an der Macht gebrandmarkt zu werden. Die Frage verdiente es vielleicht, gestellt zu werden, aber die Einstimmigkeit der Antwort erweckte mein Misstrauen.
In der Münchener Ausstellung „Verbotene Bücher“ wurde zwar die Zensur vergangener Zeiten angeprangert, für heute jedoch die Unzulässigkeit abweichender Meinungen gerechtfertigt:
Die Entwicklung hin zu einer offenen, diversen, pluralistischen Gesellschaft ist holprig. (…) Eine Sensibilisierung dafür, dass bestimmte Darstellungen unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr entsprechen, könnte ein Gewinn für alle sein.
Das muss man erst einmal schaffen, solche in sich widersprüchlichen und vor allem dem vermeintlichen Anliegen der Ausstellung widersprechenden Aussagen ohne Störgefühle auf einer Tafel zu vereinen.
Der Grund ist natürlich zum einen, dass die ständig beschworene Vielfalt tatsächlich aus einer kargen Liste kanonischer Identitäten besteht, nicht etwa in der Vielfalt der Meinungen. Wenn schon Vielfalt, dann einheitlich. Aber vor allem ist es ein Beispiel dafür, dass mangelnde Vielfalt zu Einfalt führt. Man bewegt sich nur noch in sich selbst bestätigenden Kreisen und kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass andere Menschen mit guten Gründen und ehrbaren Motiven eine andere Meinung haben könnten. Das Konzept der „Kontaktschuld“ oder der Vorwurf, etwas sei „umstritten“, erklärt Einfalt zum Programm.
Das erinnert an die typische Leistungskurve totalitärer Systeme: Am Anfang beeindrucken sie mit ihrer Effizienz und Schnelligkeit, weil alle im Gleichschritt marschieren und an einem Strang ziehen. Aber genau diese vermeintliche Stärke ist ihr Verhängnis: Sie haben immer nur eine Lösung, sie suchen immer nach der einen Wahrheit, wollen immer 100 Prozent Zustimmung. So verarmen sie und koppeln sich vom Reichtum der Wirklichkeit und von der Vielfalt der Sichtweisen ab.
Selbst wenn man keine bösen Absichten unterstellt: Es ist die Vorstellung, dass die Welt eine eindeutige Struktur hat, dass es eine objektive Wahrheit gib und dass man sich dieser einen Wahrheit dann gewiss sein kann, wenn alle über ein Phänomen dieselbe Meinung haben. Schon als Kinder haben wir dieses Einheitlichkeitsideal mit dem Spruch karikiert: „Esst mehr Scheiße – fünf Milliarden Fliegen können sich nicht irren!“
Nun, es gibt durchaus andere Konzepte zum Verhältnis von Wahrheit und Vielfalt.
Die Redakteure der Bibel zum Beispiel störte es nicht, dass es zwei Schöpfungsberichte und vier Evangelien gibt, die strenggenommen nicht kompatibel sind. Offenbar waren sie der Auffassung, dass man sich mit Perspektivenvielfalt eher der Wahrheit nähert als mit widerspruchsfrei bereinigter Einheitlichkeit.
Dies gilt auch für die Schilderung der Personen: König David, eigentlich der Superstar des Alten Testaments, wird schonungslos in seinen Schwächen und Vergehen dargestellt. Nicht anders im Neuen Testament das Versagen der Jünger und ihre Streitigkeiten untereinander. Und es gibt keinen Moment, wo die Fehlbarkeit aufhört. Schon in den Heiligenlegenden des Mittelalters ändert sich das: Heilige wie Augustinus mögen in ihrem früheren Leben Sünder gewesen sein, aber nach der Bekehrung sind sie ohne Fehl und Tadel. Das ach so aufgeklärte 20. Jahrhundert empfindet selbst diesen einmaligen biografischen Bruch als Zumutung: Die Heiligen unserer Zeit, etwa die großen Führer der einschlägigen Ideologien, waren schon im Kleinkindalter edel, hilfreich und gut.
Immerhin, im Heiligsprechungsverfahren der Kirche tritt seit jeher der „Advocatus diaboli“ auf. Und im 12. und 13. Jahrhundert entstanden an den französischen Kathedralschulen die Universitäten aus der Lust am Diskurs „etsi deus non daretur“ – als ob es Gott nicht gäbe.
Gerichtsurteile, die einstimmig gefällt wurden, galten als ungültig. Das las ich neulich über 2000 Jahre alte Rechtsvorschriften im Talmud. Das Beispiel elektrisierte mich, denn es widerspricht unseren heutigen Reflexen. Aber mehr und mehr erscheint mir das Konzept eines vielfältigen Zugangs zur Welt erwachsener. Irgendwie hat die Sucht nach Einheit und Reinheit etwas von Kindern, die immer noch den ganz festen Halt der Eltern suchen.
Seltsam, dass ich mehrfach Beispiele aus der Bibel und Kirchengeschichte heranziehen musste, die man oft ganz anders verortet. Eigentlich müsste das, was ich schildere, Selbstverständlichkeit einer offenen Gesellschaft sein.
Auch in Unternehmen hat sich die Überzeugung breitgemacht, dass Entscheidungen dann am besten seien, wenn alles dafür und nichts dagegen spricht. Wenn man zeigen kann, dass sie alternativlos sind. Man vergisst, dass eine alternativlose Entscheidung gar keine Entscheidung ist. Man vergisst, dass Alternativlosigkeit kein erstrebenswerter Zustand ist, sondern ein anderes Wort für Gefängnis oder ein Indikator für Phantasielosigkeit. Selbst zum Paradies haben Adam und Eva möglichst schnell eine Alternative gesucht. Ups – schon wieder die Bibel.
Neulich sah ich in der Überschrift zu einem Artikel der italienischen Ministerpräsidentin Georgia Meloni die Formulierung „Warum ich rechts bin“. Das fand ich gut. Möglicherweise habe ich von A bis Z eine völlig andere Meinung als Meloni, aber dieser eine Satz macht die ganze Denkfaulheit und Selbstsicherheit derjenigen zunichte, die glauben, es reiche, „gegen rechts“ zu sein. Von jetzt ab kann man den Rechten nicht mehr vorwerfen, dass sie rechts seien, sondern man muss begründen, warum man nicht rechts sein sollte. Auf diese Diskussionen freue ich mich. Und ich hoffe, dass die Sich-links-Fühlenden aus ihrer kuscheligen Wagenburg herauskommen und sich der offenen argumentativen Feldschlacht stellen. Ich bin sicher, dass das nicht zur Spaltung beiträgt, sondern wir alle besser werden und wieder lernen, miteinander zu reden und zu streiten.
Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel "Links oder rechts oder was?" veröffentlicht. Seine Kolumne "Oben & Unten" erscheint jeden zweiten Mittwoch.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus