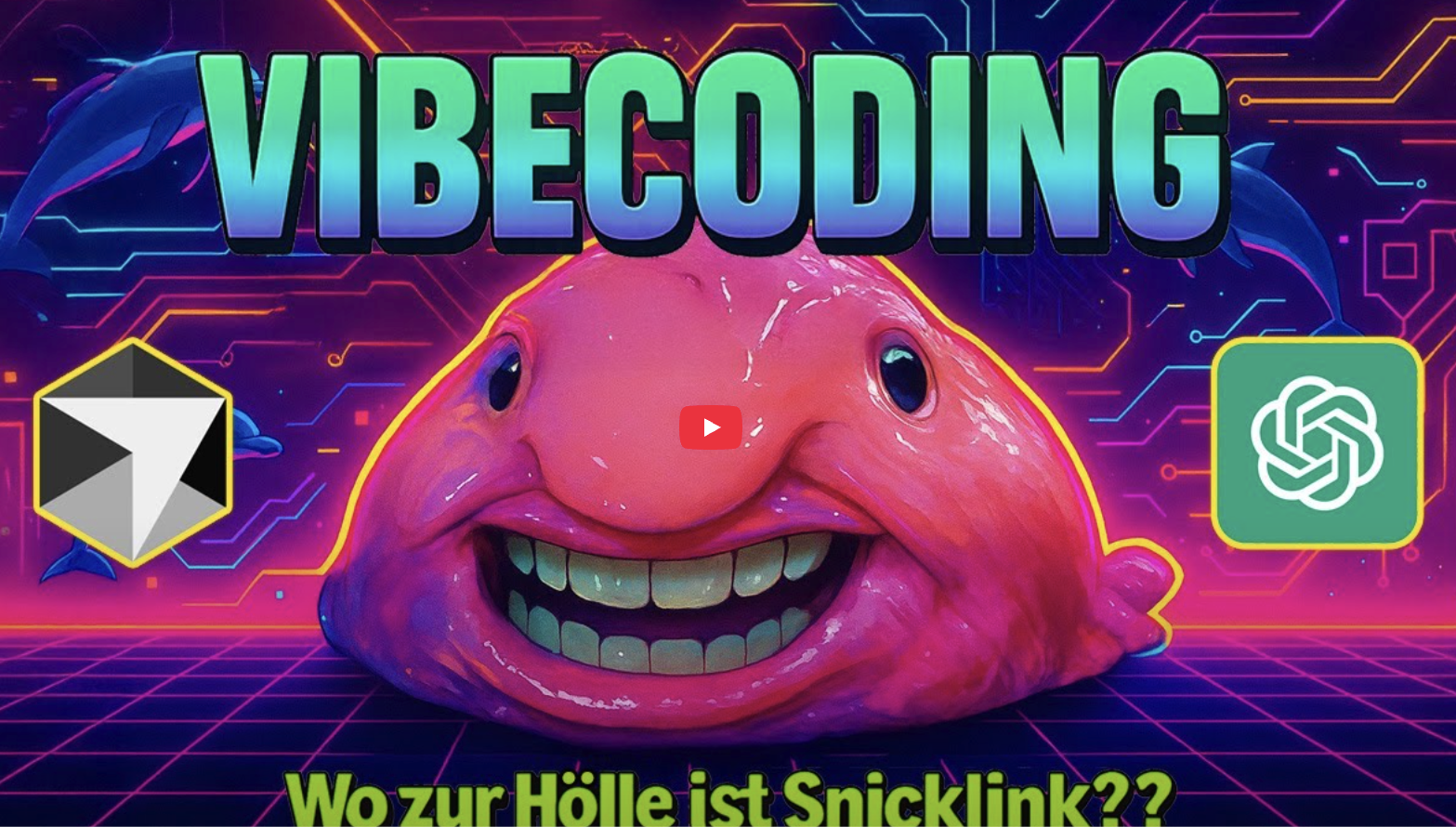
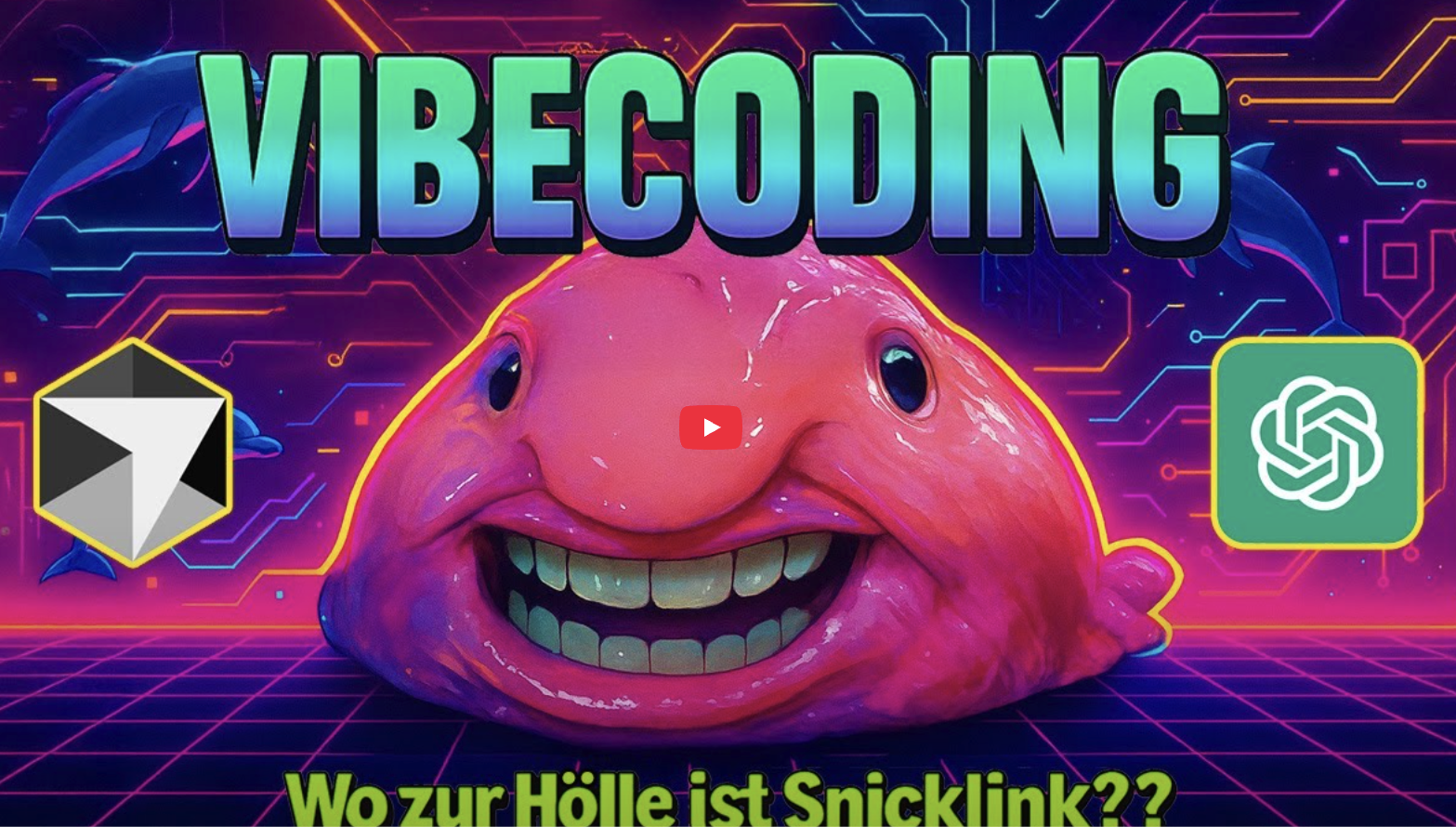
Wenn vom linearen Fernsehen die Rede ist, schwingt im Jahr 2025 bereits ein Hauch von Rückwärtsgewandtheit mit. Selbst die Boomergeneration setzt sich nur noch selten vor ein Gerät und schaut, „was gerade läuft“. Längst heißt Unterhaltung: „Unterhaltung on demand“, also auf Abruf – YouTube, Insta, TikTok, Netflix.
Wir haben uns als Gesellschaft damit abgefunden und genießen die Vorzüge der selbstbestimmten Programmwahl. Es ist mir egal, wann etwas läuft – ich schaue, wann ich will. Selten gewordene Ausnahmen sind Großereignisse wie Olympia oder Fußball – hier will man schließlich wirklich live dabei sein. Doch selbst dann öffnet unsereins meist die ZDF-Webseite am Computer. Kaum ein Deutscher unter 35 hat noch einen Fernsehanschluss.
Inzwischen schwingt für mich schon dann eine Prise Nostalgie mit, wenn ich im elterlichen Haushalt tatsächlich das Fernsehprogramm mit der Fernbedienung auswähle. Was kommt eigentlich nach Platz eins und zwei? Das „dritte“ Programm? Wohl eher nicht. RTL? Sat.1? Gegenüber den unterirdischen Inhalten des Privatfernsehens fühlt sich YouTube geradezu wie eine kollektive Befreiung aus der medialen Unmündigkeit an.
Nun – ein noch radikalerer Schritt wird „Vibecoding“ sein. Kennen Sie nicht? Bleiben Sie dran, ich nehme erst einmal eine kurze Ausfahrt, bevor ich auf die Unterhaltung der Zukunft zu sprechen komme. Zuerst stelle ich Ihnen jemanden vor: Der KI-Künstler Snicklink wurde mit viralen Internetvideos populär, die aus Deepfakes, Songparodien und Verballhornungen bestehen. In den vergangenen Jahren nahm er sich vorwiegend den Irrsinn der Coronajahre und der Ampelregierung vor und erreichte damit internationale Bekanntheit. Während Snicklink in früheren Jahren für Tele5 und extra3 arbeitete, ist er heute neben seiner Videokunst Herausgeber des Satiremagazins Die neue Willy.
Von Berufs wegen beschäftigt sich Snicklink also mit Künstlicher Intelligenz – und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Er bezeichnet sich als Simulationstheoretiker und sieht die Welt als „Code“. Nachdem es in den vergangenen drei Monaten still um das Internetphänomen geworden war, meldete er sich kürzlich in einem Video zurück und erklärt seine Auszeit: Er brauchte neue Inspiration. Vor zwei bis drei Jahren war Snicklink der Erste, der mit Deepfakes, Stimm- und Faceswaps experimentierte – heute macht das jeder. Soziale Netzwerke werden mit KI-generierten Inhalten geradezu geflutet. Er selbst, sagt er, fühlt dabei keinen Kick mehr. Also: sich Zeit nehmen, bis die Muße wieder küsst. Dazu ist es nun gekommen.
KI ermöglicht es inzwischen auch Menschen ohne Vorkenntnisse zu programmieren. Snicklink sieht das Coden als Sprache, mit der man Geschichten erzählen kann. Er spricht über das Konzept, intuitiv und stimmungsgeleitet ein Programm mit einer grundlegenden Vision zu beauftragen, Prototypen zu erstellen und dann immer komplexer werdende Projekte zu entwickeln. Diese Idee nennt man „Vibecoding“. Der Begriff geht auf den Gründer von OpenAI (ChatGPT) zurück. Snicklink begann, seinen Kindheitstraum des Spieleprogrammierens zu verwirklichen, indem er per Sprachbefehl sein erstes Spiel entwarf: den Kanzler-Simulator. Er war erstaunt, wie schnell möglich war, was früher Monate und ein ganzes Team benötigt hätte. Auf diese Weise entstanden dann komplexere Spiele in Moorhuhn-Ästhetik – Call of Blackrock, Kanzler Merz gewidmet, und der Chemtrail Fighter, wo sprühende Flugzeuge bekämpft werden.
Vielleicht ahnen Sie schon, was das alles mit der Zukunft der Unterhaltung zu tun haben könnte. Geht man einmal weg von Videospielen und wendet eben jenes „Vibecoding“ auf Unterhaltung per se an, so landet man bei MOGEN – der Begriff Modulares Generatives Entertainment stammt von Snicklink selbst. Die Vorstellung, dass nicht mehr jeder die gleiche Serie auf Netflix sieht, sondern die Sendungen aus KI-Schauspielern bestehen und die Ereignisse und Themen an die Nutzerpräferenzen angepasst werden (ähnlich personalisierter Werbung), wird dabei noch übertroffen. MOGEN geht weiter.
In Zukunft wird es möglich sein, nicht nur Spiele, sondern „endloses Entertainment“ zu erstellen. Ein digitales Theaterstück, das entsteht, während man es schaut. Alle Variablen des Stücks – Charaktere, Setting, Themen, Dialoge – sind veränder- und formbar. Das modulare System verbindet über APIs (Programmierschnittstellen) KI-Systeme für Stimme, Persönlichkeit, Bilder und Musik. Ein wesentliches Element ist die Interaktion des Publikums über einen Chat, wodurch Zuschauer Wünsche äußern und die Show sowie die Charaktere direkt beeinflussen können.
Snicklink ist überzeugt, dass dies die Zukunft der Unterhaltung ist, da es den Trend zur Personalisierung fortsetzt. Langfristig wird daraus sogenanntes „Custom Entertainment“, bei dem ein Videospiel, ein Film oder eine Serie zielgruppengerecht – auf eine Generation, eine Schicht, eine Wählerschaft oder einen Haushalt – angepasst werden können. Drastisch ausgedrückt sorgt dies dafür, dass zwei Menschen kaum mehr die gleichen Inhalte konsumieren werden. Es ist möglich, dass wir Unterhaltung, an der wir nicht aktiv, in Echtzeit mitwirken können, schon bald als öde empfinden. So wie lineares Fernsehen.
Zu Ende gedacht, wird dies einige disruptive Entwicklungen vorantreiben. Schon jetzt sorgt die unterschiedliche Mediennutzung zum Auseinanderdriften von Lebensrealitäten und bildet Filterblasen. Personalisierte und in Echtzeit von Konsumenten generierte KI-Endlosunterhaltung: Das könnte die zwischenmenschliche Entfremdung auf die Spitze treiben.
Diese Kolumne will aber nicht bewerten, sondern nur zeigen, wohin die Reise gehen könnte. Snicklink betont in der Schilderung seiner persönlichen Reise durch die letzten Monate, wie sehr ihn die Auseinandersetzung mit der neuen Technologie inspiriert – und für kreative Höhenflüge gesorgt hat.
Wir stehen vor einer krassen Veränderung, sagt er. Er setze aber immer auf „Quality first“. Es gehe darum, ein gutes Produkt abzuliefern. Im Grunde arbeitet Snicklink immer mit Sprache. Sprache ist Handwerk. Das Handwerk verändert sich – und Snicklink geht mit der Zeit.
Wollen wir da mitgehen?
Aron Morhoff studierte Medienethik und ist Absolvent der Freien Akademie für Medien & Journalismus. In seiner Liveshow "Addictive Programming" geht es um Popkultur, Medienkritik und Bewusstseinserweiterung.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus