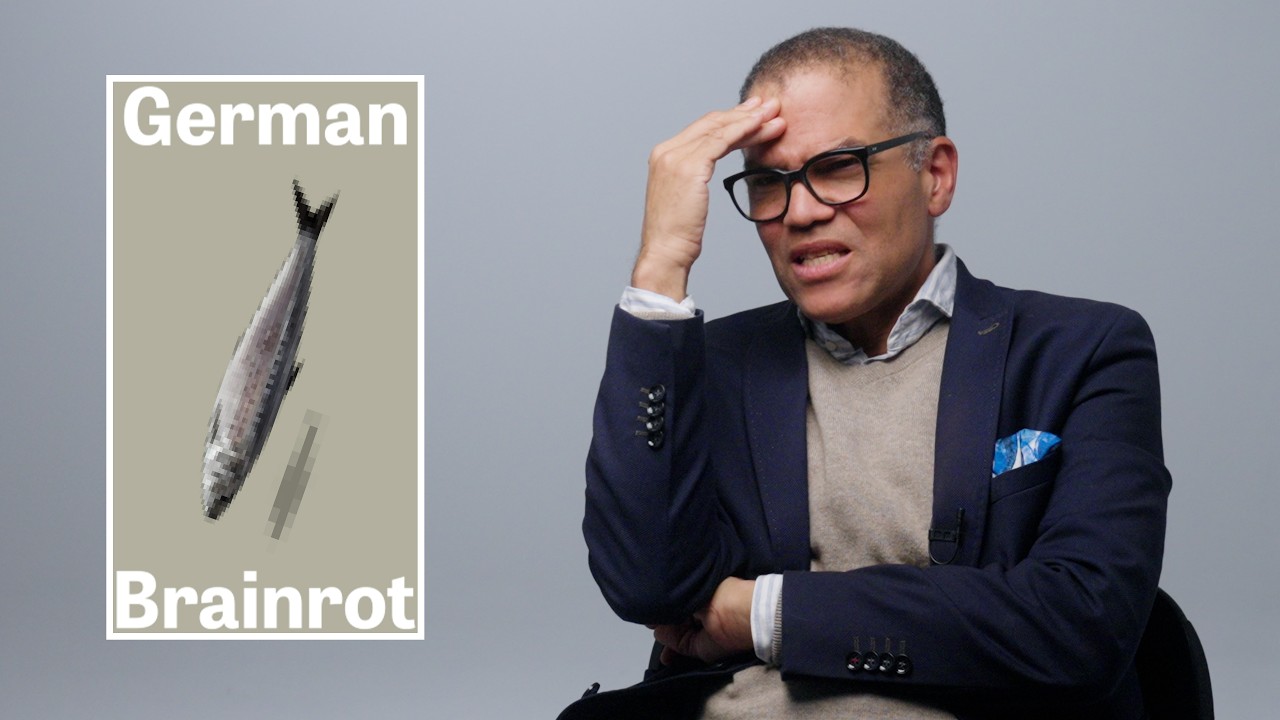
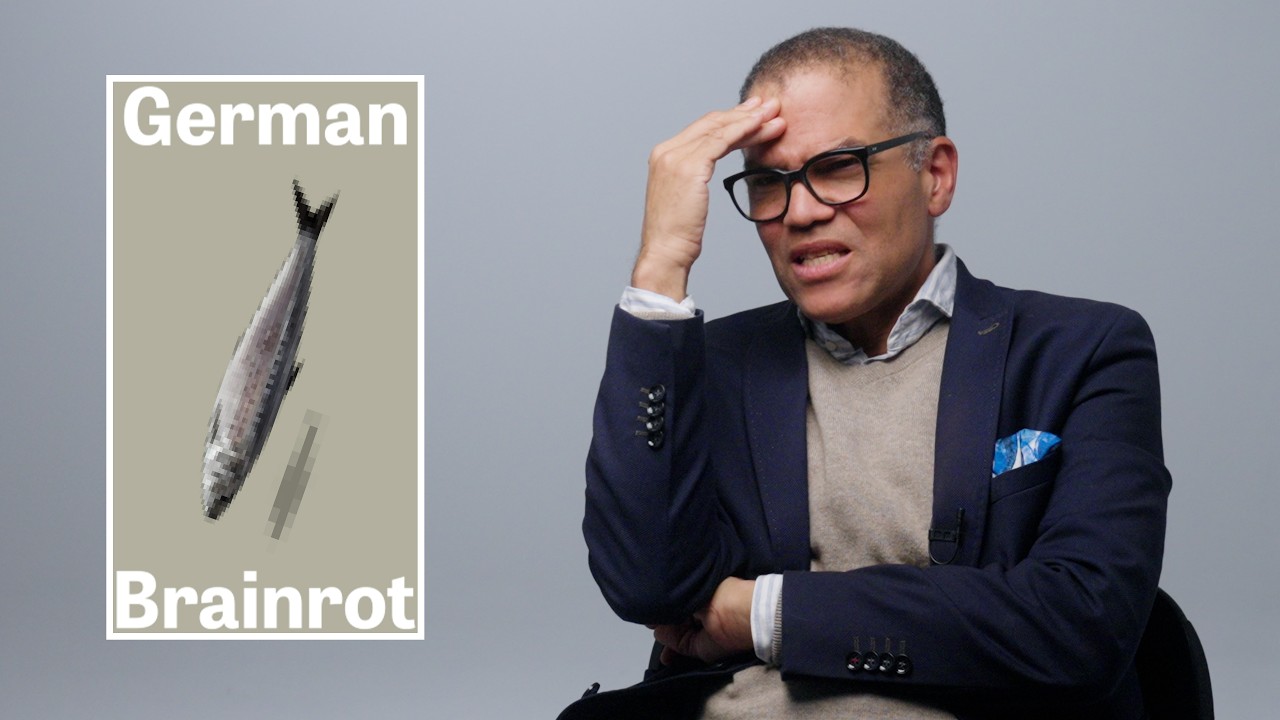
Brainrot-Videos oder Brainrot-Memes sind Inhalte von expliziter Sinnlosigkeit, geringer Produktionsqualität und dumpfer Reizfülle. Es ist Content, den man als komplett inhaltsleer bezeichnen könnte. Wie also kommt die ZEIT dazu, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen?
Der Literaturkritiker Ijoma Mangold ist an Neuem stets interessiert. Bitcoin beispielsweise, übe auf ihn eine Faszination aus, die sich durch die Komplexität, durch die intellektuelle Herausforderung des Gegenstands erkläre und weil das Thema – ähnlich dem Häuten einer Zwiebel – nie aufhöre. Im September 2023 sprach er darüber zwei Stunden mit Finanzbuchautor Marc Friedrich, womit der gebürtige Heidelberger unter Beweis stellte, auf Kontaktschuld zu pfeifen.
Nun also die Auseinandersetzung mit „Hirnfäule“, einem Internettrend – warum? Mangold attestiert in seinem viralen Reactionvideo, es handele sich „in Wahrheit [um] ein semiotisches Spiel mit Zeichen“. Sichtlich amüsiert setzt er sich mit den inhaltsleeren Videos auseinander, die zu verstehen und zu fassen es eigentlich die kulturellen Codes der Generationen Z und Alpha benötigt. Mangolds Offenheit dem Thema gegenüber äußert sich mehrmals in hörbarem Lachen: „Das ist der herrlichste grobe Unfug, der mir seit Langem begegnet ist.“
Brainrot – das ist zum Beispiel ein vertikal rotierender Fisch, recht schlecht animiert natürlich. Kommentiert wird das Video von einer „Alexa“-ähnlichen Computerstimme: „Vertikal rotierender Fisch.“ Das ist bereits alles. Mangold zieht hier den Vergleich mit Magrittes „Ceci n'est pas une pipe“ – schließlich sei ein sich vertikal drehender Fisch kein Fisch. Die Begleitung der eigentlich unterfordernden Animation mit hochtrabenden Fremdwörtern wie „vertikal“ und „rotieren“ allerdings lasse „seine Interpretationsmaschine arbeiten“, so Mangold. Dadaismus, Surrealismus, na gut, aber ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? In Anlehnung an Hape Kerkelings legendäre Kulturkritiker-Parodie – ein bisschen viel „Hurz“?
Ein von „Schnecke_123“ im Dezember 2024 auf TikTok gepostetes Kurzvideo gilt als Beginn des Genres in seiner deutschen Ästhetik. Eine Taube läuft durch einen Einkaufsladen und packt „Salamistöckchen“, Durstlöscher und „Maggi Fürze“ in ihren Einkaufswagen. Der typische Bruch erfolgt dann mit einer Aufzählung, die so gar nicht reinpasst, nämlich „die Scheidungspapiere meiner Frau“. Hierzu Mangold: „Manchmal meint man, Sinnzusammenhänge zu haben, und dann ist es doch wieder non sequitur, sodass das Nächste aus dem Vorhergegangenen überhaupt nicht folgt.“ Mit diesem „Bruch“ arbeite der Clip (und der Humor allgemein) die ganze Zeit. In den „Salamistöckchen“ sieht Mangold eine Gegenbewegung zur Übermacht der Anglizismen – es sei schon wieder uncool, alles auf Englisch zu bezeichnen, deswegen würde das Spiel mit absurd deutschen Begriffen wieder „in“ sein.
Das Design der Videos erinnert an die bauklotzartigen Minecraft-Spiele, die vor wenigen Tagen einen eigenen Kinofilm bekommen haben. Auch hier liegt die Faszination in der Reduktion, in einer Auflehnung gegen die makellose Ästhetik, wie sie bei einem anderen Trend – KI Deepfakes – das Ziel der Übung ist. Ein wiederkehrendes Motiv der deutschen Brainrot-Videos ist eine Taube, die im alltäglichen Kontext Auto fährt, spazieren geht oder einkauft. Mangold sieht hier – ähnlich der im Netz beliebten Katzenvideos – ein Spiel mit der Anthropomorphisierung von Tieren, gepaart mit einer typisch deutschen Warenwelt („Haben Sie eine Paypack-Karte“), die auch im Ausland für Belustigung sorgt und gleichzeitig universell verstanden wird. „As a person who doesn't know a word of German, I find this hilarious“, lautet ein TikTok-Kommentar.
Genug also der Erklärungen und bedeutungsschwangeren Einordnungen und zurück zur Frage, ob es das braucht und ob es nicht Mangold ist, der sich hier zum Affen macht. Mangold widerspricht und legt noch einen drauf: „Vielleicht ruft es auch Anspielungshorizonte ab, die mir leider unbekannt sind. Der Ehrgeiz, kein Zeichen zu übersehen und die, die man wahrnimmt, richtig zu deuten, ist sehr groß. Man würde gerne diesem dadaistischen Spiel auf höchster Ebene gerecht werden.“
Sich in der spießigen Literaturkritiker-Bubble mit derart neuartigen Inhalten zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht genau die Einstellung, die uns auch gesamtgesellschaftlich weiterbringt. Frei von Berührungsängsten und mit echtem Interesse öffnen wir uns so den Welten, die uns sonst verborgen bleiben. Ergibt trotzdem keinen Sinn? Noch einmal Ijoma Mangold: „In der Notwendigkeit liegt kein Witz, sondern diese müssen wir erleiden und ertragen. Es ist die Randomness, die Zufälligkeit, an der sich das absurde Theater der Welt ausdrückt, an dem wir Spaß empfinden können.“
Aron Morhoff studierte Medienethik und ist Absolvent der Freien Akademie für Medien & Journalismus. In seiner Liveshow "Addictive Programming" geht es um Popkultur, Medienkritik und Bewusstseinserweiterung.
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus