

Die Werkzeuge, die für die Arbeiten im Kloster benötigt werden, soll man nach der Ordensregel genauso sorgfältig behandeln wie das heilige Altargerät.
Lebensweg
Abt Thomas Maria Freihart OSB stammt aus einer Bauernfamilie mit acht Kindern. Im Alter von 20 Jahren trat er als Novize in die Abtei Plankstetten ein. Er studierte Theologie an der Katholischen Universität Eichstätt und setzte seine Studien fort an der Benediktinerhochschule Sant Anselmo in Rom. Nach mehreren Funktionen in den Abteien von Plankstetten und Weltenburg wurde er 1998 zum 70. Abt des Klosters Weltenburg gewählt. Auf dem Foto in der Mitte zwischen Axel Klopprogge (links) und dem Architekten Gunter Henn bei einer Gesprächsrunde zum Thema „Arbeit, Arbeitsorte, Leerräume und Zwischenräume“ aus Anlass des 20jährigen Bestehens des Goinger Kreises am 25. Mai 2025.
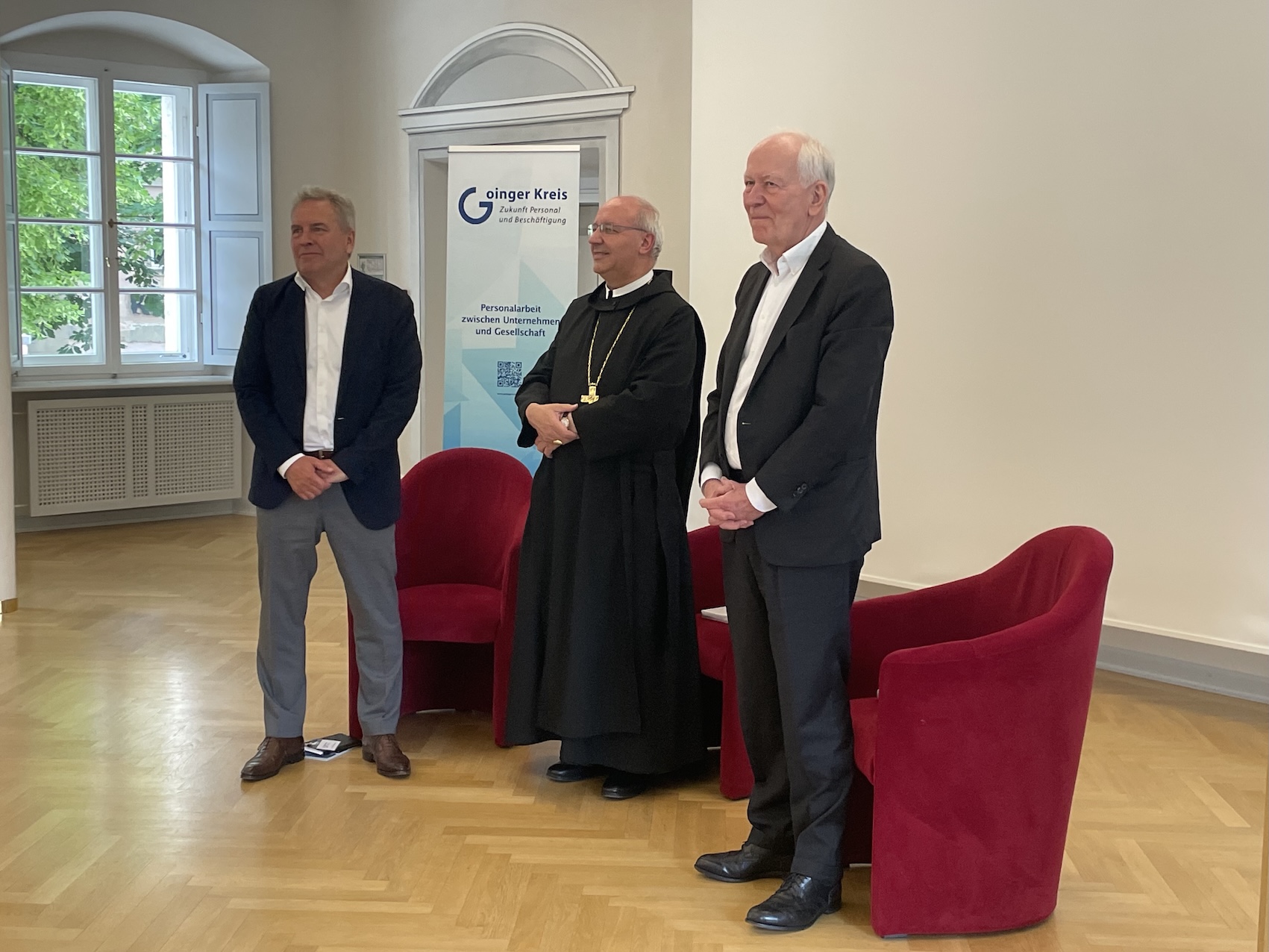
Herr Abt, Religion, Glaube, Kirche – all das wird heute irgendwie beim Geistig-Seelischen eingeordnet. In der Bibel trifft man auf ein anderes Bild. Zwar findet man Sätze wie „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, also neben dem Wirtschaftsteil gibt es auch noch ein Feuilleton. Aber eigentlich drängt sich das Lebensnahe, das Anfassbare, ja oft Unverblümte und Drastische der Geschichten auf. Auch nach dem Tod geht es nicht um Seelenwanderung, sondern die Bibel redet von der Auferstehung des Fleisches.
Der Eindruck täuscht nicht. Die Bibel sieht den Menschen ganzheitlich. Der Leib gehört dazu. Das Christentum ist nicht leibfeindlich. Jesus hat gegessen und getrunken. Im Vaterunser bitten wir um das tägliche Brot. Die Speisung der Fünftausend erkennt an, dass die Menschen nach der Bergpredigt einfach Hunger hatten und etwas zu essen benötigten. Wenn das Jesuskind von Maria in Windeln gewickelt wurde, dann heißt es auch, dass es aus bekannten Gründen Windeln brauchte. Das alles mag auch eine allegorische Bedeutung haben, aber man sollte nicht zu schnell ins Unverbindlich-Symbolische ausweichen. Dem Alten wie dem Neuen Testament ist wichtig, dass die Ereignisse ganz real zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und unter Angabe namentlich genannter Zeugen stattgefunden haben. Die Schilderungen zur Passionsgeschichte sind voller Körperlichkeit bis an die Schmerzgrenze. Auch nach der Auferstehung isst und trinkt Jesus und lässt den ungläubigen Thomas seine Wunden betasten.
Über die Gestalten der Bibel wissen wir in der Regel sehr wenig. So wenig, dass man in der kritischen Bibelforschung des 19. Jahrhunderts bezweifelte, dass es sie überhaupt gab. Aber so wenig wir wissen, neben dem Namen und dem Herkunftsort kennen wir fast immer den Beruf.
Das stimmt. Es gibt Hirten, Ackerbauern, Fischer, Zeltmacher, Mägde, Hausfrauen, Soldaten, Banker, Könige, aber auch Steuereintreiber, Prostituierte und vieles mehr. Und in den Gleichnissen Jesu kommen ebenfalls Arbeiter im Weinberg, Verwalter und viele andere praktische Tätigkeiten vor. Das gilt auch für Jesus selbst. Sein Vater Joseph war Zimmermann. Im griechischen Originaltext steht das Wort „tekton“ – heute würde man vielleicht Baumeister oder Bauunternehmer sagen. Wir gehen davon aus, dass Jesus bis zum dreißigsten Lebensjahr diesen Beruf ausgeübt hat. In diesen Jahren hat er seine Gebäude nicht mit Zaubersprüchen gebaut, sondern ausgemessen, gesägt, gehämmert oder was immer man damals in diesem Beruf tat.
Ist das Zufall oder hat es eine tiefere Bedeutung?
Nun, es zeigt zum einen, dass für die Bibel die Beziehung zu Gott nicht neben dem Leben, sondern mitten im Leben stattfindet. Es zeigt auch, dass die Bibel nicht im theologischen Seminar entstand, sondern unter ganz praktischen Leuten. Aber wie einige Äußerungen des Apostels Paulus zeigen, ist das Verhältnis zur Arbeit noch viel radikaler. Im zweiten Brief an die Gemeinde in Thessalonich, einem der ältesten Texte im Neuen Testament überhaupt, kritisiert er scharf diejenigen Glaubensbrüder, die auf Kosten der Gemeinde leben, ohne zu arbeiten. Wie auch in anderen Briefen hebt er hervor, dass er selbst nicht auf Kosten der Gemeinde gelebt hat, obwohl er als Apostel und Gründer der Gemeinde dazu das Recht gehabt hätte. Er betont, dass er seinen Lebensunterhalt selbst verdient – Paulus war Zeltmacher. Und er formuliert sehr scharf: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

Wie passt das zur Aussage Jesu: „Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch.“ Ist das nicht die Aufforderung, nichts zu tun, wenn man nur auf der richtigen Seite der Heilsgeschichte steht?
Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Es ist vielmehr eine Ermutigung an diejenigen, die sich nicht trauen. Ich meine das nicht nur in Bezug auf die gefährliche Aufgabe der Missionare, an die sich diese Botschaft richtete. Jeder, der handelt und gestaltet, weiß, dass man mit dem eigenen Tun immer nur einen Teil der Faktoren beeinflusst. Man braucht immer das Vertrauen, dass auch die Faktoren irgendwie zusammenpassen, die man vorher nicht kennt und nicht beeinflussen kann. Auch als Abt ist mir das oft genug passiert. Es ist ein Geschenk, dass man mit guten Leuten zusammenkommt, die man um Rat fragen kann oder die einem in schwierigen Momenten helfen. Wer dieses Vertrauen nicht hat, wird in seinen Ängsten und Bedenken steckenbleiben und niemals mit dem wirklichen Tun beginnen.
„Ora et labora – Bete und arbeite“ ist als Motto der Benediktinermönche bekannt. Was hat das mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben?
Gleich zu Anfang seiner Mönchsregel wettert Benedikt von Nursia gegen zwei von vier Arten zeitgenössischer Mönche. Die „Sarabiten“ nennt er widerlich, weil sie nur nach eigenem Gutdünken leben. Für noch schlimmer hält er die sogenannten „Gyrovagen“. Sie ziehen umher und lassen sich für drei oder vier Tage in verschiedenen Klöstern beherbergen. Sie sind für ihn Sklaven der Gelüste ihres Gaumens. Auch wenn die Sprache nicht immer so derb ist wie bei Benedikt, hat die Kirche auch die Säulenheiligen nie besonders gemocht. Eine Frömmigkeit, die sich zur Schau stellt und nur funktioniert, weil andere nicht auf Säulen hocken, sondern arbeiten, erschien der Kirche nie als ein vorbildhaftes und nachhaltiges Modell.
Und die Lösung sieht Benedikt in der Arbeit?
Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Eigentlich sind es drei Elemente, die den Tag eines Mönches bestimmen „Ora, lege et labora“, also beten, die Heilige Schrift lesen und meditieren sowie arbeiten. Die Arbeit hat dabei zum einen eine wohltuende Wirkung für den Einzelnen. Benedikt sagt, Müßiggang sei der Seele Feind. Zum anderen geht es um die wirtschaftliche Autarkie des Klosters. Das Kloster soll niemandem auf der Tasche liegen. Mönche sind für Benedikt erst dann wahre Mönche, wenn sie wie die Mönchsväter und die Apostel von ihrer Hände Arbeit leben. Und schließlich geht Benedikt davon aus, dass ein Kloster etwas herstellt, das man verkaufen kann. Damit kann man über den Eigenbedarf hinaus Erträge erwirtschaften, mit denen man Gutes tun kann.
Was muss man sich unter der Arbeit der Mönche damals vorstellen?
Erinnern wir uns an Paulus: Seine Tätigkeit als Missionar, als Gründer und Manager der neuen Gemeinden betrachtet er selbst nicht als Arbeit. Sehr wohl jedoch die Tätigkeit in seinem Beruf als Zeltmacher. Genauso direkt und handfest meint es Benedikt: Es geht um echte Handarbeit in einem landwirtschaftlich-handwerklichen Sinne, jeden Tag mehrere Stunden zu festgelegten Zeiten. Die Zeiten richten sich nach dem Sonnenstand und nach dem, was in der Jahreszeit zu tun ist. Die Mönche sollen die Ernte einbringen. Andere sollen sich als Handwerker nützlich machen. Ohne Ausnahme soll jeder Mönch in der Küche arbeiten und die anderen Mönche bei Tisch bedienen. Ebenso helfen alle beim Putzen und Waschen. Wer krank oder gebrechlich ist, wird deswegen nicht automatisch komplett freigestellt, sondern er soll die Arbeit tun, die er entsprechend seinem Gesundheitszustand tun kann. An vielen Stellen betont Benedikt den Grundansatz: Stets auf den einzelnen eingehen, ihn unterstützen, ihn nicht überfordern, aber ihn auch niemals unterfordern.
War das zur Zeit Benedikts etwas Besonderes?
Auf jeden Fall. Vor allem war es in der Gesellschaft nicht selbstverständlich. Benedikt gründete das Kloster in Monte Cassino der Überlieferung nach im Jahre 529. Es war die römische Spätantike, die Zeit, in der die prächtigen Bauten in Ravenna entstanden. Ein freier, reicher, gescheiter Mann arbeitete nicht. Er verwaltete seine Besitzungen, er war politisch oder philosophisch tätig, aber er war an praktischer Arbeit nicht interessiert. Maurus und Placidus, frühe Schüler von Benedikt, stammten aus dem römischen Adel – Kochen und Putzen gehörte gewiss nicht zu ihrer Sozialisation. Das galt auch im Mittelalter – trotzdem besaß das Klosterleben eine große Anziehungskraft auf vornehme Frauen und Männer.
 Bild: Basilica Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, gebaut im zweiten Viertel des sechsten Jahrhunderts (Foto: Berthold Werner, Public domain)
Bild: Basilica Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, gebaut im zweiten Viertel des sechsten Jahrhunderts (Foto: Berthold Werner, Public domain)
Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?
Später haben Mönche und Nonnen auch andere Dinge gemacht. Sie haben etwa in den Klosterschulen unterrichtet, die Jungen wie Mädchen offenstanden. Dann wurden in den Klöstern Bücher abgeschrieben, ohne diese Arbeit wüssten wir wenig vom geistigen Erbe der Antike. Aus vielen Klagen mittelalterlicher Mönche wissen wir, dass die stundenlange Kopiertätigkeit echte Knochenarbeit war. Aber Landbau und Handwerk spielten immer eine große Rolle. Der im 12. Jahrhundert gegründete Zisterzienserorden ging in die Einöde und baute dort landwirtschaftliche Mustergüter auf.
War Arbeit eine Strafe, sozusagen Zwangsarbeit?
Sie war wie beschrieben verpflichtender Teil des Konzeptes, aber auf keinen Fall eine Strafe. Im Gegenteil, in der Regel des Benedikt findet sich die umgekehrte Anweisung: Wenn sich ein Handwerker-Mönch zu viel auf sein Können einbildet, dann soll man ihm seine Arbeit nehmen, bis er wieder zur Bescheidenheit zurückgekehrt ist. Und bemerkenswert: Die Werkzeuge, die für die Arbeiten im Kloster benötigt werden, soll man nach der Ordensregel genauso sorgfältig behandeln wie das heilige Altargerät.
Was bedeutet das Arbeitsgebot heute konkret im Kloster Weltenburg?
Natürlich haben sich Dinge gewandelt. Mit sieben Brüdern können wir die Felder, die zum Kloster gehören, nicht selbst bestellen und auch nicht die Brauerei betreiben. In der heutigen Gesellschaft zählen auch Dienstleistungen zur Arbeit. Einige Brüder kümmern sich um das Gästehaus, sowohl um die Organisation als auch um die Seminare, die wir anbieten. Aber ein anderer Bruder ist ganz traditionell Schreiner, wofür wir sehr dankbar sind. Und alle diese Arbeiten sind keine Beschäftigungstherapie. Das Gästehaus ist eine wichtige Einnahmequelle für uns. Die Gäste erwarten, dass alles funktioniert. Und wenn man als Schreiner mit Leim oder Lasur arbeitet, kann man nicht nach Lust und Laune aufhören oder unterbrechen. Jede ernsthafte Arbeit hat ihre Zeit und ihren Ort, ihre eigene Ordnung. Es geht nicht um Romantik, sondern es muss das gemacht werden, was gemacht werden muss.
 Bild: Das Kloster 2022 (Foto: H. Helmlechner, CC BY-SA 4.0)
Bild: Das Kloster 2022 (Foto: H. Helmlechner, CC BY-SA 4.0)
Weltenburg gehört zu den ältesten Klöstern in Deutschland. Auch wenn wir das genaue Gründungsjahr nicht kennen, geht es um einen Zeitraum von 1400 Jahren. Das ist praktisch die gesamte Zeit, in der es in dieser Region überhaupt Christen gibt. In all diesen Jahrhunderten war das Kloster immer an demselben Ort. Und nicht nur ungefähr, sondern genau unten an der Donau, was wegen der Hochwassergefahr durchaus ein prekärer Ort ist. Warum ist das Kloster immer noch hier?
Manche Klöster und manche Kirchen sind an einem Ort, weil dort ein Heiligengrab ist – meistens zentimetergenau unter dem Hauptaltar. Das prominenteste Beispiel ist die Peterskirche in Rom. Das gibt es hier nicht. Wir kennen nicht den Ursprung des Klosters Weltenburg, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es unten am Wasser etwas Hilfreiches zu tun gab für eine frühe Mönchsgemeinschaft. Aber auch wenn sich Umstände ändern können, bleibt ein Kloster in der Regel dort, wo es ist. In Weltenburg gab es unfreiwillige Unterbrechungen, etwa in den Ungarnkriegen des 10. Jahrhunderts. Dann im Dreißigjährigen Krieg, als der Abt von den Schweden verschleppt wurde und die Mönche ins befestigte Kelheim fliehen mussten. Und schließlich nach der Säkularisation und Auflösung aller Klöster 1803 in Bayern. Aber die Mönche kehrten immer wieder zurück, und zwar nicht irgendwohin, sondern genau an diesen schmalen Streifen zwischen Donau und Frauenberg.
Warum ist die Ortsbindung so wichtig, auch wenn sich der Kontext ändert?
Die „stabilitas loci“, die Ortsbindung, ist ein Gegenmodell zu den Wandermönchen. Wir wollen Wurzeln haben. Wir wollen mit den Herausforderungen und Grenzen leben, die an einem bestimmten Ort gegeben sind. Wir bleiben bei den Menschen, die in einer Region leben. Wir bleiben auch bei denen, die vor uns hier als Mönche gelebt haben. Wir können nur hier sein, weil 1400 Jahre lang andere vor uns hier waren. Ohne sie gäbe es das alles nicht. Das ist auch ein Stück Dankbarkeit. Es gibt eine Treue zum Ort. Aber nach unserer Überzeugung funktioniert es auch nur, weil es eine Treue Gottes zu diesem Ort gibt.
Hat die Ortsbindung über dieses geistige Selbstverständnis hinaus weitere Folgen?
Auf jeden Fall. Aus der Ortsbindung ergibt sich der regionale Bezug und umgekehrt. Nach der Ordensregel sollen die Gewänder der Mönche aus den Materialien hergestellt werden, die die Region hergibt. Wenn ein Kloster dem Ideal der Selbstversorgung folgt, muss es mit dem auskommen, was in der Gegend wächst. Diese Vorstellung der Regionalität war sicher eine Zeitlang in den Hintergrund geraten. Aber heute ist sie wieder ganz aktuell und wir greifen sie gerne auf. Im Februar gibt es eben keine Kirschen. Dafür gehört das Bier zu unserer Region.
Ein Kloster ist auch ein Gebäude. Viele Menschen besuchen Klöster auch heute wegen der Architektur. Was sind die wichtigsten Elemente und was haben sie mit dem Leben und Tun der Mönche zu tun?
Das Wichtigste ist natürlich die Kirche, in der wir uns mehrmals täglich zum Stundengebet und zur Messe versammeln. Dann gibt es die Klosterzellen – unsere Wohnräume. Benedikt schreibt noch einen gemeinsamen Schlafsaal vor, aber mit dem Aufkommen des Individualismus um das Jahr 1500 breiten sich die Einzelzellen aus. Das Refektorium ist der zentrale Gemeinschaftsort. Hier essen wir gemeinsam, hier wird vorgelesen. Dann gibt es die Bibliothek und die anderen Arbeitsräume. Und schließlich ist der Kreuzgang ein wichtiges Element. Er umschließt, aber er kesselt nicht ein. Er ist auch ein Prozessionsweg mit den Kreuzstationen. Insgesamt ist der innere Bereich des Klosters geschlossen, eben die Klausur. Hier kommen keine Besucher herein, auch nicht die Familienangehörigen der Brüder, schon gar nicht die zahlreichen Touristen, die Weltenburg jeden Tag besuchen.
 Bild: Weltenburg 2012 (Foto: BKP, CC BY-SA 3.0)
Bild: Weltenburg 2012 (Foto: BKP, CC BY-SA 3.0)
Wie Sie beschreiben, hat sich manches im Laufe der Zeit geändert und an die jeweiligen Verhältnisse angepasst. Was sind die drei Elemente, die unverrückbar sind?
Erstens: Nichts ist wichtiger als der Gottesdienst. Auch die Arbeit muss so organisiert werden, dass sie damit nicht kollidiert. Zweitens die Gütergemeinschaft. Arbeit ist Ausdruck unserer Solidarität. Das Ergebnis kommt in eine gemeinsame Kasse. Jeder bekommt das, was er braucht. Und drittens die grundsätzliche Struktur und Hierarchie des Klosters.
Sie erwähnen die Hierarchie, die auch in der Ordensregel eine große Rolle spielt. Haben Sie einen Chef?
Eigentlich nur den Papst in Rom. Ansonsten gibt es zwar Kongregationen der Benediktinerklöster und es gibt auch Visitationen, aber der Orden ist eine Art föderaler Organisation. Im Prinzip ist jedes Kloster eigenständig und muss mit seiner Arbeit in seiner Region zurechtkommen.
Das Interview wurde im Frühjahr 2024 von Axel Klopprogge geführt – für das Buch „Liebeserklärung an die Arbeit. Was Arbeit ausmacht, wie sie uns bereichert und wie wir sie wertschätzen müssen“ des Goinger Kreises. Wir danken dem Goinger Kreis für die Möglichkeit zur erneuten Wiedergabe.
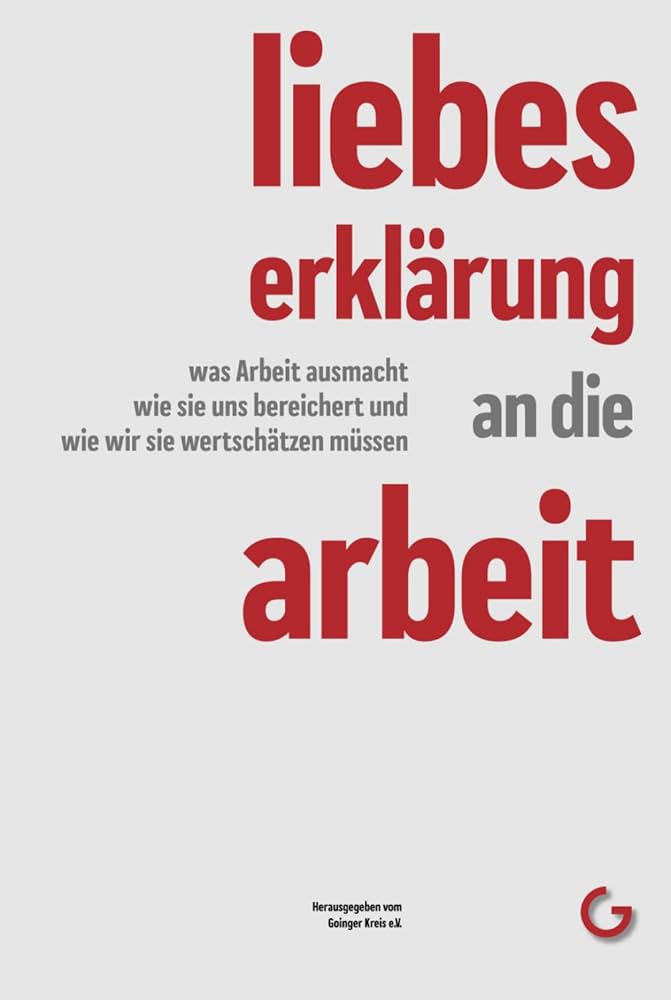
Besucht man das Kloster Weltenburg, dann fällt sofort die Lage ins Auge: Das Kloster liegt seit jeher hochwassergefährdet direkt an der Donau und nicht auf dem wenige Meter entfernten Sockel des Frauenberges. Bei näherer Beschäftigung erweist sich, dass der Standort des Klosters nicht immer so einsam und ländlich war, wie er heute erscheinen mag.
Auf dem Michelsberg direkt am anderen Donauufer befand sich zwischen dem dritten und ersten vorchristlichen Jahrhundert ein keltisches Oppidum namens „Alkimoennis“. Mit einer Fläche von 600 Hektar war es eines der größten seiner Art in ganz Europa. Die Siedlung wurde durch kilometerlange Mauern geschützt. Das Gebiet ist von zahlreichen eisenzeitlichen und mittelalterlichen Erzschürfstellen überzogen. Im Boden lassen sich bis drei Meter dicke Schichten aus Kohle und Schlacke finden. Offenbar handelte es sich bei Alkimoennis um einen frühgeschichtlichen „Industriekomplex“, auf dem im großen Stil Eisenerz im Tagebau gewonnen und verhüttet wurde. Auch auf dem Frauenberg oberhalb des Klosters lassen sich mehrere Wälle, Gräberfelder und Schürfgruben erkennen.
In der Römerzeit entwickelte sich die Region zu einem militärisch-verkehrsmäßigen Knotenpunkt. Schon 45 nach Christus lag bei Weltenburg der Ausgangspunkt einer römischen Grenz- und Militärstraße, die an der Donau stromaufwärts bis Donaueschingen führte. Diese Donausüdstraße war lange Zeit eine der beiden wichtigsten Ost-West-Verbindungen nördlich der Alpen. Auf dem Frauenberg sowie in der näheren Umgebung gab es mehrere Kastelle sowie römische Militärbäder. Wenige Kilometer entfernt begann der Obergermanisch-Rätische Limes, der bis an den Rhein führte.
Es liegt nahe, dass das Kloster in der Gründungszeit eine Aufgabe wahrnahm, die mit diesem Kontext zu tun hatte und nur unten am Fluss zu erfüllen war. Eine lokale Überlieferung besagt, dass das Kloster um das Jahr 617 durch iro-schottische Mönche nach den Regeln des Heiligen Kolumban gegründet wurde. Dies gilt in der Forschung mittlerweile als widerlegt. Archäologische Funde zeigen jedoch, dass das Gebiet um Weltenburg um 600 christlich geprägt war. Weltenburg ist möglicherweise das älteste Kloster Bayerns.
Im 8. Jahrhundert übernahmen die Weltenburger Mönche die Ordensregeln des Heiligen Benedikt. Während der Ungarneinfälle im frühen 10. Jahrhundert verließen die Mönche die Abtei. 932 wurde Weltenburg wieder besiedelt. Im Zuge der Säkularisation in Bayern wurde 1803 auch das Kloster Weltenburg aufgelöst, 1842 jedoch neu errichtet und 1913 wieder zur Abtei erhoben. Zum Thema Arbeit: Dass Mönche in Weltenburg Bier brauten, ist erstmals für das Jahr 1050 belegt, weshalb Weltenburg mit der Bezeichnung „Älteste Klosterbrauerei der Welt“ wirbt. Das „Weltenburger Kloster Barock Dunkel“ wurde mehrfach als bestes Dunkelbier der Welt ausgezeichnet.
 Bild: Weltenburg 2007 (Foto: Guido Radig, CC BY 3.0)
Bild: Weltenburg 2007 (Foto: Guido Radig, CC BY 3.0)
Berichte, Interviews, Analysen
Freie Akademie für Medien & Journalismus